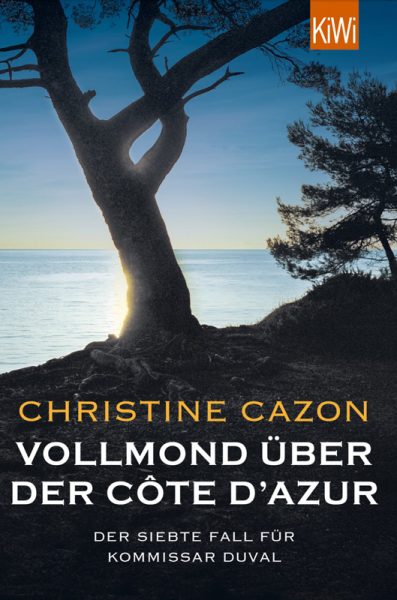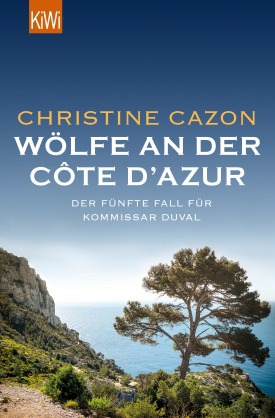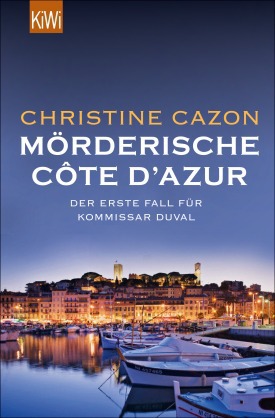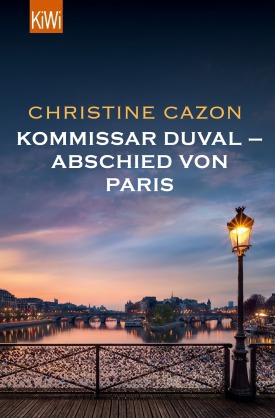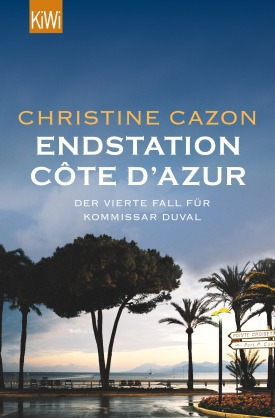Ich habe auch gebacken. Schon zwei Fuhren Christstollen, der, obwohl ich ja jetzt alles haarklein vom letzten Jahr dokumentiert hatte und ihm all meine Zeit und Liebe gab, dennoch nur so halbherzig aufging und der sich dieses Jahr trotz gleichem Ofen und gleicher Backtemperatur doch nicht als richtig durchgebacken erwies. Ich werde ihn trotzdem am Samstag zum kleinen Weihnachtsmarkt in den Bergen mitnehmen,auch wenn ich dort einmal gerne “richtig” guten Christstollen verkaufen möchte, das heißt nicht nur geschmacklich gut sondern auch schön mürbe, wie er meistens beim dritten Mal backen für enge Freunde und die Familie wird. Es braucht, scheint es, jedes Jahr drei Anläufe, aber es fällt mir dieses Jahr schwer, mich noch ein drittes Mal aufzuraffen, so richtig will le plaisir de le faire soi-même, die Freude am selber backen, wie neulich die Kassiererin an der Supermarktkasse sagte, als sie alle meine Backzutaten sah und mich neugierig in ein Gespräch über das Backen und das Christstollenbacken insbesondere verwickelte (sagte ich schon einmal irgendwo, dass Franzosen gerne plaudern?!) und ich jammerte, dass die Zutaten allein schon teurer seien als ein fertiger Christstollen, den es im gleichen Laden nämlich auch zu kaufen gibt, diese Freude, ich nehme den Satz wieder auf, damit Sie sich nicht unvermutet allein mit dem letzten Stummelchen des Hauptsatzes wiederfinden, will sich nicht einstellen. Aber so leicht komme ich nicht davon, nachdem ich diese Tradition einmal eingeführt habe, kann ich sie nicht mehr abschaffen: “NEI-IIIN” schrie meine französische Familie empört auf, als ich versuchte anzudeuten, dass es dieses Jahr vielleicht keinen Christstollen gäbe. Kommt gar nicht in die Tüte, der gehört jetzt dazu und basta! Nun – um mich zwischenzeitlich zu entspannen, habe ich mich dieses Jahr an Springerle gewagt. Die Springerle kamen zu mir, um ehrlich zu sein, ich habe beim Ausräumen eines Kämmerchens in einer Kiste die alten Modeln wiedergefunden, sie hin- und hergedreht und erst nachdem sie Weihnachtsdekorationsmäßig eher wenig hergaben, dachte ich, vielleicht soll ich dieses Jahr Springerle backen. Springerle und der Geschmack nach Anis gehören irgendwie zu meiner Kindheit. Wobei, wenn ich mich recht entsinne, das Springerlebacken eine hohe Kunst ist. Das Muster muss schön erhaben sein, weiß müssen sie bleiben, Füßchen müssen sie kriegen und zu alledem müssen sie weich werden. Springerle sind wohl kurz nach dem Backen schön weich, haben dann aber Tendenz hart zu werden und hart zu bleiben. Weich kriegen wir sie hier spätestens beim Eintunken, dachte ich, denn hier wird ja alles in den Kaffee oder Tee getunkt, was zumindest eine der Herausforderungen abmildert. Im Internet stieß ich auf eine freundlich aussehende Springerle Seite, die ein schwäbisches und ein schweizerisches Rezept anbot. Ich begann zu lesen und schluckte. Obwohl ich die benötigten Zugaben wie Kirschwasser (der Alkohol!) und Hirschhornsalz tatsächlich habe, bereitete mir das schwäbische Rezept schon beim Lesen Kopfschmerzen; es erfordert geduldige Hausfrauenhände und vor allem ein geduldiges Gemüt, mit beidem ist eine schwäbische Hausfrau vielleicht, ich bin aber ganz bestimmt nicht damit ausgestattet. Niemals kann ich das, dachte ich und las, schon resigniert, das schweizerisch Rezept durch. Wieso ist das Rezept bei den Schweizern so viel einfacher?! Ich weiß es nicht, entschloss mich aber kurzerhand dann eben schweizerische Springerle, Änisbrötli heißen die Springerle hier, zu backen. Wird vielleicht nicht ganz der Geschmack von früher, aber vielleicht kriege ich es so hin, dachte ich. Und siehe da, alles ist einfach. Der Teig wird tatsächlich wie Seide, eine Eigenschaft, die ich beim Lesen amüsant fand, mir aber nicht vorstellen konnte, wie aus Eiern, Puderzucker und Mehl etwas Seidiges werden könne. Es wurde seidig! Es rollte sich gut aus, und ich stellte fest, was ich wohl noch tief in irgendwelchen Hinrwendungen aus früherer Zeit als Beobachterin abgespeichert hatte, dass einige Modeln, so schön sie aussehen, ungeeignet sind, weil zu tief, zu flach oder zu kompliziert geschnitzt. Gut gehen schlichte Formen: das Kleeblatt, der Hund, der Ochsenkopf und die Eichel – alles andere wird nichts rechtes. Sie ruhten 24 Stunden und dann saß ich mit angehaltenem Atem vor dem Ofen und sah zu, wie meine Springerle Füßchen bekamen. Einfach so. Und weich waren sie auch. Und dann muss es ja zu irgendwas gut sein, dass man jahrein, jahraus in einem feuchten Haus wohnt, denn die kurzzeitig harten Springerle ergaben sich alsbald der kühlen Feuchte des Speisekämmerchens, in der regelmäßig alles schimmelt und wurden in ihrem Karton, nein nicht schimmelig, aber so wie es sein soll: schön knusprig von außen und innen weich.
Die erste Fuhre sah (wie Sie oben sehen) noch sehr grob-handwerklich aus, das Geschick beim Modeln und Ausschneiden war beim zweiten Mal Backen (gestern, sind nämlich schon alle aufgegessen!) schon besser, und vielleicht wage ich mich eines Tages doch noch an das schwäbische Rezept – allein um den geschmacklichen Unterschied kennenzulernen. Bis dahin fehlt mir nichts, denn ich finde sie gar köstlich (wie gesagt, alle schon weg!) und bis zum andersschmeckenden Beweis würde ich sagen: So müssen Springerle sein und schmecken! Hurra!
 ps: aus dem Teigrest habe ich natürlich die empfohlenen Chräbeli gemacht! Sie haben auch Füßchen!
ps: aus dem Teigrest habe ich natürlich die empfohlenen Chräbeli gemacht! Sie haben auch Füßchen!