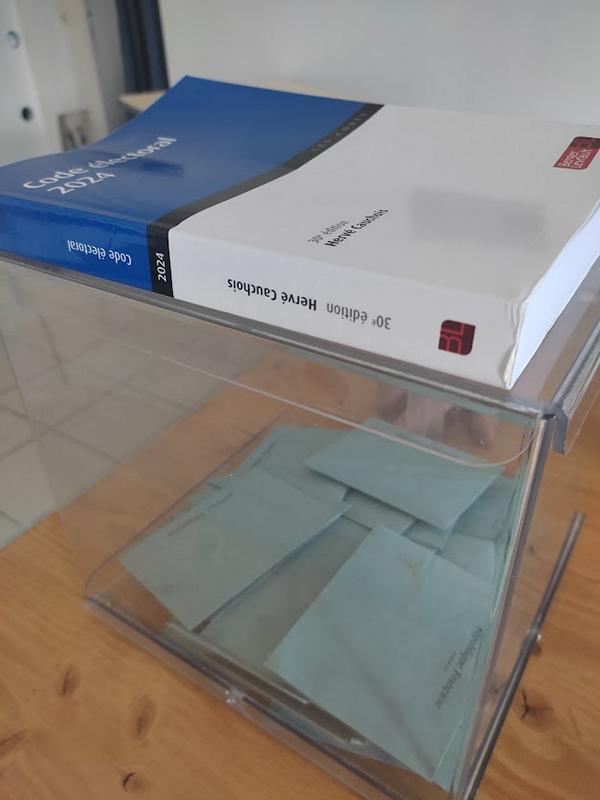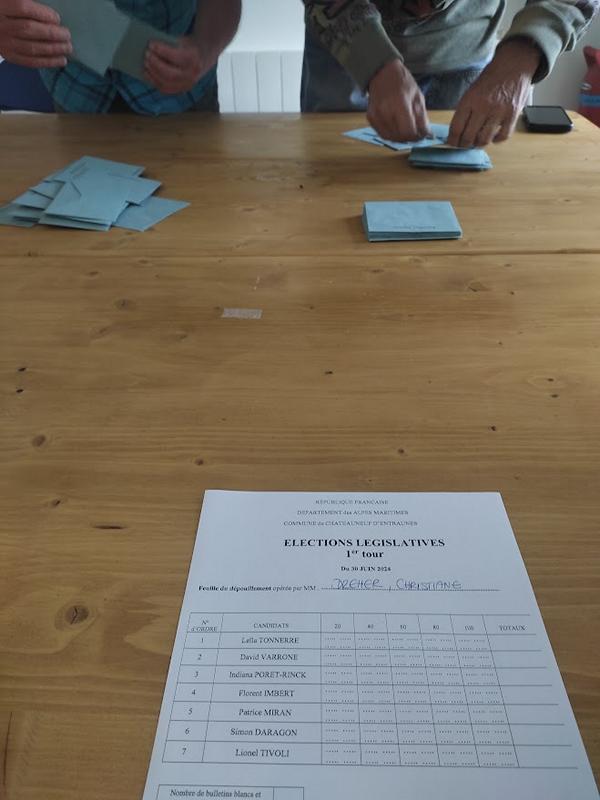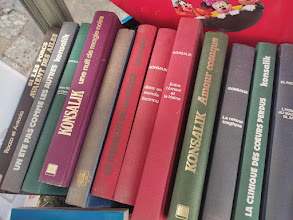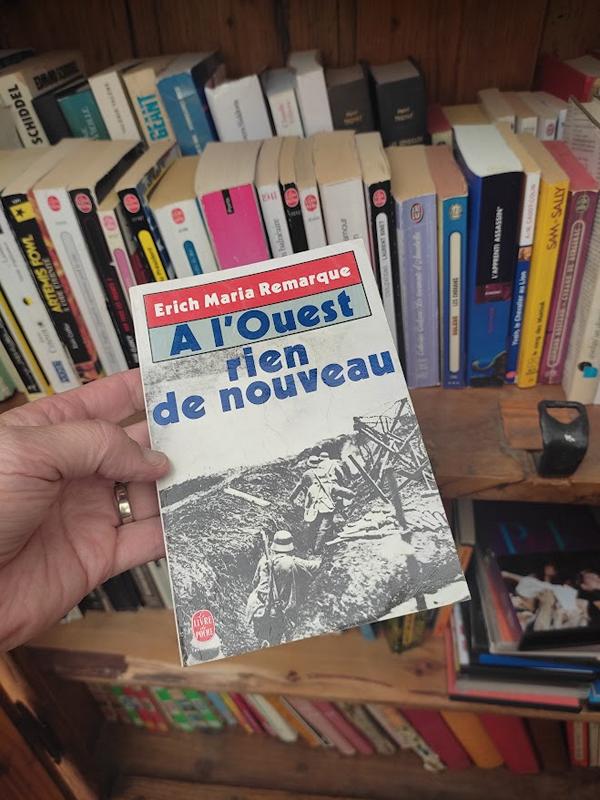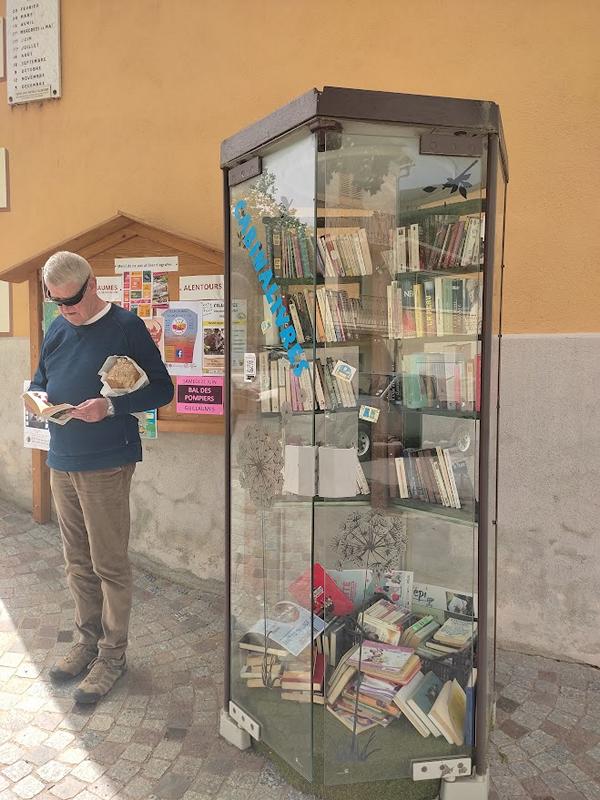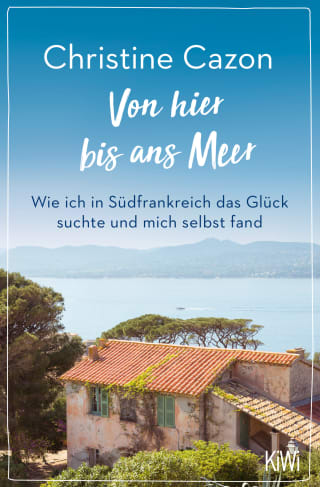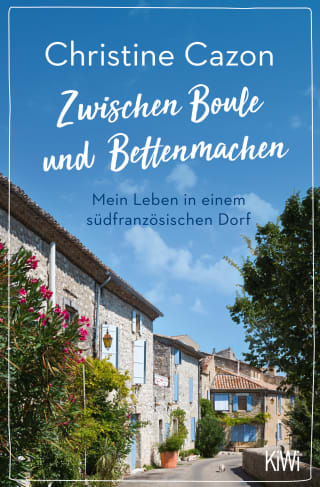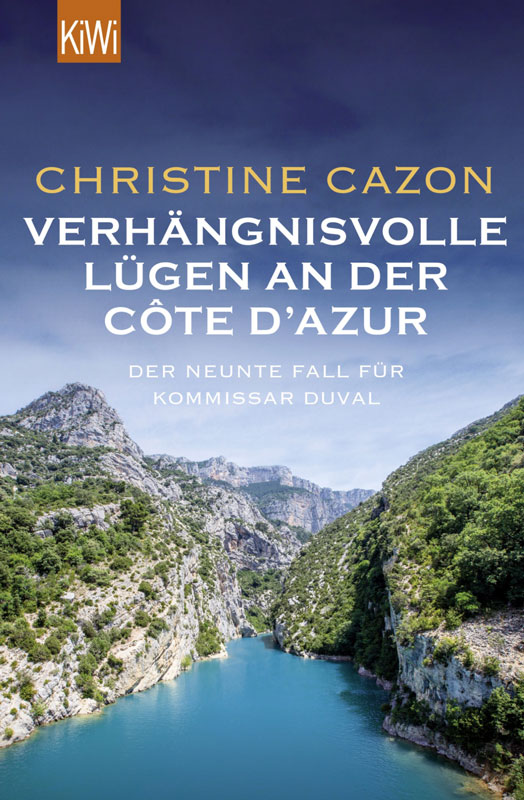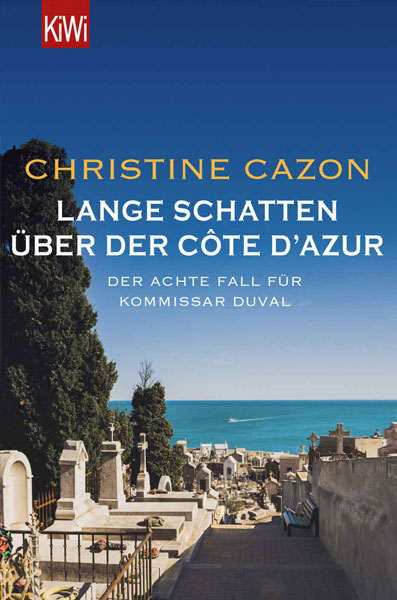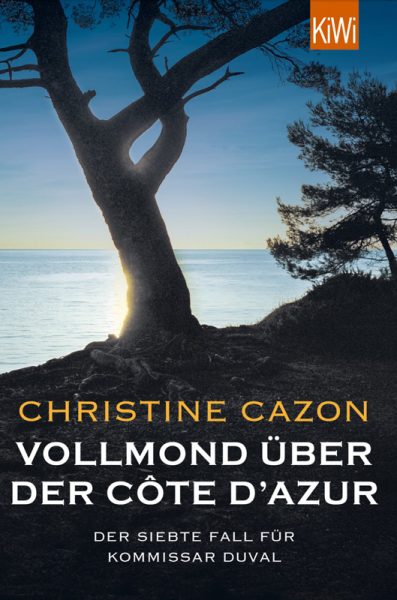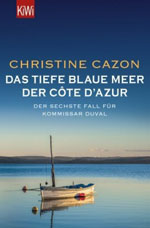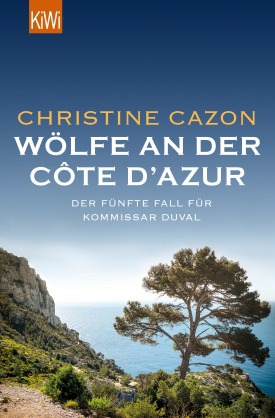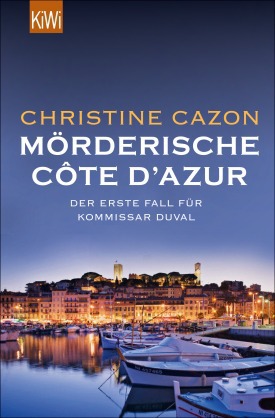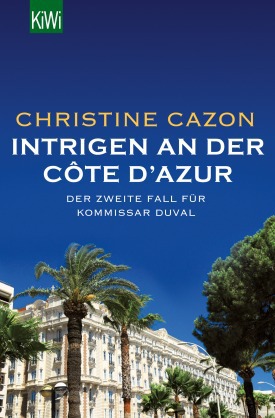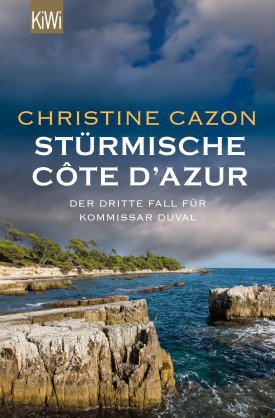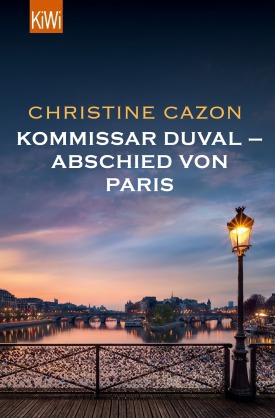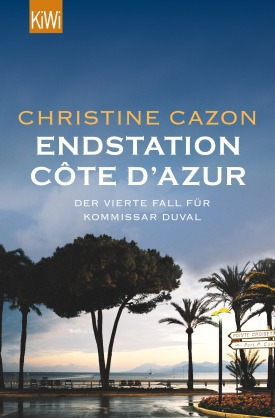Heute ist Gestern war der letzte Tag der Tour de France, das Einzelzeitfahren zwischen Monaco und Nizza ist war aber ehrlich gesagt ein bisschen langweilig, zumindest vor dem Fernseher, hundertmal den Aufstieg zur Turbie und nach Èze, immer dieselben hysterischen Fans am Straßenrand, und nur sehr wenige Landschaftsaufnahmen. Hier Èze.

(Und wie man auf dem Fernsehfoto sieht, werden hier die Tage bis zur Eröffnung des nächsten Sportevents, den Jeux Olympiques, schon runtergezählt.)
Die Journalistin, die die Radfahrer in Nizza kurz hinter der Ziellinie mit falschen Informationen und eher unhöflichen Fragen abfängt, war mir unerträglich: “Wow, Sie sind die beste Zeit gefahren!” “Nein, ich bin vierter!” “Sie sind erster!” “Ah bon?” Der Radfahrer schaut irritiert und informiert sich: “Nein, vierter!” sagt er dann. Später passiert ihr das noch einmal mit einem sichtlich enttäuschten Fahrer: “Glückwunsch, Sie sind elfter!” “Ich bin keinesfalls elfter, es sind ja noch zig Fahrer unterwegs”. Sie unbeirrt: “Na, im Moment sind Sie jedenfalls elfter!” Und dann zum selben Fahrer: “Die Tour ist nicht so gut gelaufen für Sie, was? Sind Sie enttäuscht?”
Es ist schon den ganzen Tag bedeckt, zumindest in Cannes, die angesagten Gewitter, die die schwüle Hitze mal kurzfristig unterbrechen könnten, wollen aber nicht kommen. Was allerdings beim offenen Fenster kommt, sind Stechmücken und die wummernden Bässe von irgendeinem Electro-Plage-Konzert. Leben, wo andere Urlaub machen, so schön.
Ok, so viel war gestern, es hat dann nicht geregnet, zumindest nicht bei uns. Dafür sollen es heute 32 Grad werden. Ächz.
Bucket Lists oder “Löffellisten”
Im Grunde habe ich keine Wunschliste mit Dingen, die ich vor meinem Tod noch erlebt, getan oder gesehen haben möchte. Oder nicht mehr. Dass ich “ein Jahr im Ausland leben” wollte, wissen Sie. Das war, lange bevor es diese “Bucket Lists” oder “Löffellisten” gab, mein unausgesprochener Lebenswunsch (übrigens: “Löffelliste”, für die, die es nicht wissen sollten, ist die Wunschliste der Dinge, die man noch tun möchte, bevor man “den Löffel abgibt”). Dadurch, dass ich das gemacht habe, ist die “Löffelliste” ziemlich leer geworden, und dadurch, dass ich in diesem Land geblieben bin, mit all den Herausforderungen des täglichen Lebens, sind andere große Wünsche gar nicht erst aufgekommen. Große Reisen oder eine Weltreise zum Beispiel. Um Gottes willen! Ich bin immer noch jeden Tag in einem fremden Land unterwegs. Das reicht mir, ich muss nirgendwo mehr hin. Jedenfalls nicht mit der Dringlichkeit, mit der ich damals hierher musste. Ich habe ein anderes Leben gefunden, einen lieben Mann, und damit es nicht zu langweilig wird, eine herausfordernde Familie, aber vor allem habe ich hier Frieden mit mir selbst geschlossen und anderen vergeben. Genug für ein Leben, denke ich. Ich könnte durchaus den Löffel abgeben.
Aber kleine Wünsche sind manchmal da. Vor einigen Jahren habe ich in einer dieser Sendungen, die man sich manchmal aus Verlegenheit am Freitagabend anschaut, einen Holzbildhauer entdeckt und seitdem den Wunsch, eines seiner Werke zu besitzen. Ich erkundigte mich und erhielt eine Liste seiner Werke. Große und kleine, alle sehr originell, und es waren Werke dabei, die in meinen finanziellen Möglichkeiten lagen, aber ich bin ein haptischer Mensch, es sind Holzskulpturen, ich hätte sie gerne vorher gesehen und angefasst. Der Künstler lebt in einem Dorf in den Bergen bei Grenoble, es lag nie auf dem Weg, es gab Wichtigeres, und die Tatsache, dass Monsieur nicht annähernd von der Idee beseelt war, dorthin zu fahren, “haben wir nicht schon genug Kunst?”, verhinderte, dass wir beim letzten Familientreffen, wo wir schon einmal ziemlich nah dran waren, nicht noch ein Stündchen weitergefahren sind. Im Nachhinein habe ich mich sehr geärgert, dass ich es nicht durchgesetzt hatte.
Kürzlich waren wir wieder in der Gegend, und ich dachte, wenn wir es dieses Jahr nicht machen, dann machen wir es nie, und so habe ich zusätzlich ein kleines Ausflugsprogramm für uns zusammengestellt, die Anreise und die Übernachtungen geplant, und siehe da, Monsieur war einverstanden. Zuerst fuhren wir nämlich an einen Ort, den er schon immer mal sehen wollte, an den Genfersee, ans französische Ufer und über Evian und Montreux nach Vevey. Die Fahrt dauerte viel länger als erwartet, es gab Baustellen und die Fahrt am See war mit Stop and Go nicht so idyllisch. Später hat es auch noch geregnet. Evian und Montreux erinnerten mich dezent an Cannes, wir hielten nicht an, fuhren einfach durch und weiter. In Vevey, besser in einem Stadtteil von Vevey, soll das Grab von Graham Greene sein. Wir kamen zur besten Mittagszeit an, stiefelten aber pflichtschuldigst erst einmal zum gut ausgeschilderten Friedhof, denn dort liegt auch Charlie Chaplin nebst Gattin begraben.

Deren Grab fanden wir schnell, das Grab von Graham Greene nicht. Vergeblich suchten wir alle Gräber des kleinen Friedhofs ab, der sich an der Aktion “Mähfreier Mai” beteiligte.



Das kleine Rathaus, in dem wir uns hätten informieren können, hatte bis 14 Uhr Mittagspause, auch wir gingen erst einmal etwas essen. Im Rathaus hat man später nie etwas von Graham Greene gehört. Ich hatte in der Schweiz kein Internet, aber ich schwöre, dass ich diese Information im Internet gefunden habe. Irgendjemand hatte Mitleid und suchte und fand die erlösende Nachricht: Graham Greene liegt nicht in Corsier-sur-Vevey, sondern in Corseaux, einem anderen Ortsteil, ein paar Straßen weiter, mit einem eigenen kleinen Friedhof. Und dort liegt er. Graham Greene. Monsieur ist nicht nur ein Fan, sondern auch ein Forscher, der vor zehn Jahren ein Buch veröffentlicht hat, das, wie das Grab des Autors, ein wenig brach liegt. Monsieur hat sich aber sofort daran gemacht, das Grab ein wenig vom wuchernden Unkraut zu befreien.


Eigentlich würden wir beide jetzt gerne in Vevey bleiben, für den Tag reicht es, meinen wir, aber ich habe bei der Planung unsere (vor allem meine) Energie über- und die Straßenverhältnisse völlig unterschätzt und uns mutig ein Zimmer in einem Bergdorf in den Chartreuses gebucht. Da wir am nächsten Abend in der Villa Puebla in Barcelonette und am Samstag in unserem Bergdorf sein wollen, gibt es keinen zeitlichen Spielraum. Also fahren wir zurück Richtung Chambéry und dann in die Berge, und dort zu einem winzigen Dorf. Auch die Bergstraßen, deren Enge und Kurven mir überhaupt keine Angst machen, nerven mich am Ende des Tages. Das ist schade, denn die Landschaft ist wunderschön, und dass das kleine Hotel, das ich mir abgelegen und ruhig vorgestellt habe, an diesem Abend für ein Fest privatisiert wurde, so dass wir dort auch nicht essen können, lässt mich nur noch stöhnen.
Der Zugang zu den Zimmern läuft über Codes, die mir angeblich aufs Handy geschickt wurden, aber ich finde sie nicht, kann mir die Erklärungen des ungeduldigen jungen Mannes, der sechzig Gäste zu bewirten hat, nicht mehr merken und fühle mich alt und nur noch sehr müde. Viel passiert an diesem Abend nicht mehr, ich will weder irgendwohin laufen noch fahren, dabei wäre das Dorf sicher einen Spaziergang wert, und nur dem Sculpteur, der nichts von unserer Ankunft ahnt, schicke ich noch eine Nachricht, ob wir am nächsten Tag bei ihm vorbeischauen dürfen. Das dürfen wir, antwortet er kurz darauf. Glücklich schlafe ich ein.
Am nächsten Morgen fahren wir noch ein Dorf weiter, nichts weist auf einen Künstler oder ein Atelier hin. Wenn nicht das Navigationsprogramm meines Telefons darauf bestanden hätte, wären wir daran vorbeigefahren. Aber es ist hier. Mitten im Nirgendwo. Thierry Martenon kommt mit dem Fahrrad angefahren und zeigt uns seine Werkstatt und einige Werke in seinem Ausstellungsraum.

Sie sind in jeder Hinsicht großartig. Und groß! Sehr groß! Eines dieser monumentalen Werke habe er gerade nach Südafrika verschickt, erzählt er. Die Liste der Kunstwerke, die er mir 2017 zugeschickt hat, er kann sich natürlich nicht mehr daran erinnern, ist längst nicht mehr gültig. Er stellt jetzt in Paris und New York aus und er hat keine Werke mehr einfach so herumstehen oder hängen. Er macht große und sehr große Auftragsarbeiten, aber er würde für mich etwas Kleineres kreieren – wir besprechen Holz und Struktur, Farbe und Form, ich mache Fotos und verspreche, ihm die Maße für eine Wand zu senden, an der ich das Kunstwerk sehe. Er ist natürlich, zugänglich und freundlich, und er schenkt uns zum Abschied sein Buch. Auch Monsieur, der mir zunächst sehr reserviert folgte, ist begeistert von seiner Arbeit, seinen Werken und seiner Art. Es war eine absolut bereichernde und beglückende Begegnung.
Ich verlinke Thierry Martenon, wie jeden “Geheimtipp”, mit gemischten Gefühlen: klar, er hat eine Website, klar, er hat ein Buch veröffentlicht, klar, er gibt manchmal Interviews im Fernsehen. Letzteres habe sein Leben und seine Arbeit verändert, sagt er. Seine Werke verkaufen sich nun in alle Welt. Das Holz für seine Arbeit findet er längst nicht mehr (nur) in seiner Umgebung. In der Zwischenzeit arbeitet er auch mit einem Assistenten. Thierry Martenon wollte immer nur “in den Bergen leben und mit Holz arbeiten”. Für das langsame Leben in den Bergen, das Wandern, Radfahren, Einatmen und Ausatmen will er auch weiterhin noch genug Zeit haben.