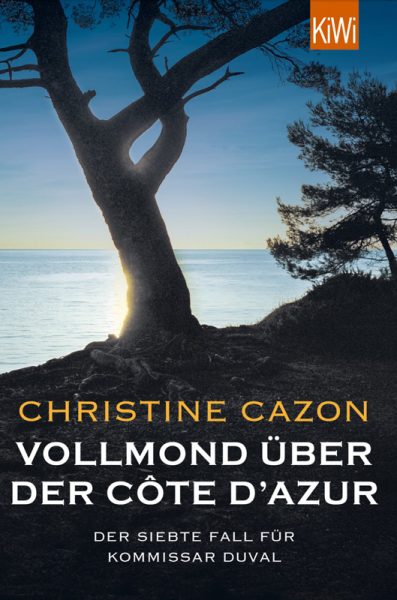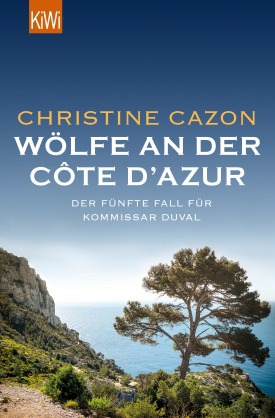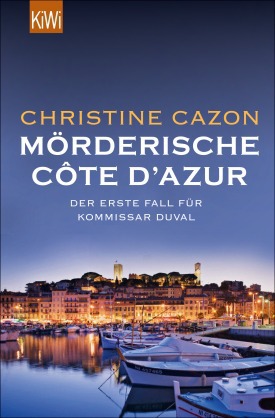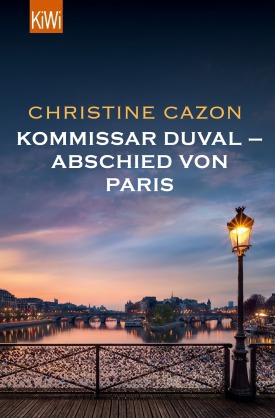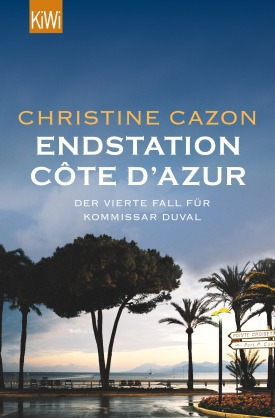Patrick hat am vierten Tag nach der ersten Chemotherapie seine Haare verloren, büschelweise blieben die grauen Löckchen gestern in der Bürste hängen, so dass wir zu einem Friseur gefahren sind und Patrick sich den Kopf rasieren ließ. Danach haben wir eine Mütze für seinen plötzlich enorm kälteempfindlichen Kopf gesucht, und Patrick hat sich – gegen meinen Wunsch – für das Modell „Schlappohr“ entschieden…
![]()
Ich finde, dass er damit so ähnlich wie Enno, der Hund aus dem Nachbarblog, aussieht. Trotz des Haarverlusts, war gestern ein guter Tag. Wir haben, da Patrick en forme war, einen kleinen Ausflug mit dem Auto gemacht, und wir sind ein bisschen in der Sonne gesessen. Wir machten Fotos vom neuen Patrick mit und ohne Mütze, und ich finde, er sieht verändert, aber gar nicht schlecht aus. Ohne Mütze zumindest.
Gestern abend machte Patrick wie gewohnt giftige Bemerkungen zu den Abendnachrichten und ich sagte „na, super, er ist wieder da, der alte Meckerer!“ Patrick lachte.
Heute ist alles anders.
Patrick hatte nachts mehrfach Durchfall, ist heute entsprechend schlapp und außerdem ist er traurig. Er fühle sich wie eine rausgerissene Pflanze, sagt er.
Ich selbst habe auch nicht gut geschlafen, hatte Alpträume, es war düster und finster in meinen Träumen, und ich hatte viel Angst. Und ich bin sofort traurig, wenn Patrick traurig ist, und habe leider auch ein bisschen leise vor mich hingeweint. Patrick ist heute schwacher Patient und ich bin schwache Krankenschwester. Das ist keine gute Kombination.
Patrick sagt, „deine Tränen machen mich nur traurig, ich will, dass du lebst, ich will dass du lachst. Ich hab dich schon so lang nicht mehr lachen hören, Christjann“.
Patrick will Normalität. Ich habe das oft gelesen, in euren Kommentaren aber auch in Büchern und Broschüren. Ich weiß, dass es das ist, was auch mir in der Krebsklinik gut tut. Der normale Umgangston der Ärzte, Schwestern, bis hin zu den Frauen, die nachmittags Tee, Kaffee und Kekse servieren. Patrick lag ja bis zur Verlegung in die Krebsklinik in einem anderen Krankenhaus. Das war und ist ein normales Krankenhaus, eine Poliklinik. Nicht, dass die Ärzte und Schwestern dort nicht nett gewesen wären, aber völlig überfordert von einem schwer kranken Krebspatienten und seinen schockierten Angehörigen. Allein gelassen wurde er und wurden wir mit der Information Krebs, die man uns quasi kurz zwischen Tür und Angel zurief. Mit Patrick sprach dann gleich gar niemand mehr „darüber“, und mit mir sprachen die Krankenschwestern so, dass mir klar wurde, es gibt keine Hoffnung mehr.
Als wir im Krebszentrum ankamen, war dort alles anders. Herzlich, freundlich, persönlich wurden wir erwartet. Ärzte, Schwestern, Pfleger von einer beeindruckenden Ruhe und, auch auf die Gefahr hin kitschig zu klingen, würde ich sagen voller Liebe, aber gleichzeitig von professioneller Sachlichkeit. Beeindruckend. Ich habe mich erleichtert und voller Hoffnung gefühlt. Außerdem wird gelacht, gescherzt, ganz normal gesprochen. Insbesondere die Pfleger haben einem rauen Witz, der mir anfangs den Mund offen stehen ließ. Aber der Effekt ist verblüffend. Lachen! Super! Angesichts all dieser Schwere und Traurigkeit kann und darf hier gelacht werden. Genial! Und dann wird normal mit uns gesprochen, und nicht so, als seien wir schon bei der Beerdigung. Und vor allem wird zuerst mit Patrick gesprochen. Er ist der Patient. In der Poliklinik passierte es mir, dass eine Schwester im Beisein von Patrick, der weder schlief noch im Koma lag, mich fragte, ob mein Mann gegen irgendwas allergisch sei. Ich sagte, „fragen Sie ihn doch einfach selbst, er ist doch da“. Ganz abgesehen davon, dass ich ihn tatsächlich noch gar nicht so lange kenne, als dass ich wüsste, ob er gegen Jod oder gegen wasweissichnoch allergisch ist. Die Situation Krankenhaus hatten wir bislang noch nicht unserer kurzen Beziehung.
Was ich sagen will, ist, mir tut sie auch gut, die Normalität. Ich will auch Normalität, aber wie geht das? Wie mach ich das? Und gehört zur Normalität nicht doch auch gerade meine Traurigkeit? Mir ist leider die meiste Zeit nicht zum Lachen zumute, außer vielleicht, wenn ich Patrick mit seiner Schlappohrmütze sehe.
Wir sahen neulich, einige Zeit bevor wir von Patricks Erkrankung wussten, zusammen einen Film, der übrigens der erneute Auslöser für Äußerungen der Kategorie Je me tire une balle war, allerdings in der Form „Wenn mir jemals so etwas passiert, musst du etwas für mich tun, so will ich nicht leben“.
Der Film heißt Le scaphandre et le papillon, „Schmetterling und Taucherglocke“ auf deutsch, wie ich gerade ergoogelt habe, ein Film der letztes Jahr in die deutschen Kinos kam. Vielleicht habt ihr ihn gesehen? Nur kurz den Inhalt für alle anderen: Es ist die ergreifende Geschichte eines Mode-Redakteurs, der nach einem Hirnschlag in ein Locked-In-Syndrom fällt, vollkommen gelähmt ist, alles sieht, versteht und erlebt, sich aber nicht äußern kann. Lediglich ein Auge bleibt ihm zur Verständigung mit der Außenwelt. Mit dem Klimpern eines Augenlids kann er anfangs nur „ja“ und „nein“ sagen, kommt aber mit Hilfe eines speziellen Alphabets so weit, sich richtig mitzuteilen (er klimpert mit dem Augenlied, wenn der ihm vorgelesene Buchstabe der ist, den er will), und so bildet er Worte, ganze Sätze, und hat so am Ende mit Hilfe einer persönlichen Assistentin seine Geschichte geschrieben, die als Buch veröffentlicht wird. Wirklich ein beeindruckender, ergreifender Film, gedreht überwiegend aus der Sicht des gelähmten Redakteurs, fühlte ich mich beim Anschauen des Films genauso eingeschlossen, wie er. Ich kam mir vor allem anfangs vor, als müsste ich ersticken.
Mich hat am meisten die Normalität der anderen beeindruckt, angesichts eines unbeweglichen Mannes, dem die Spucke aus dem Mundwinkel tropft, der angestrengt mit seinem Augenlid klimpert. Die Normalität der Freunde und Kollegen, die ihm vorlesen und ihm alles mögliche erzählen, zugegebenermaßen waren es nur sehr wenige Freunde, die meisten waren vermutlich zu abgeschreckt, so eine Erkrankung passt nicht richtig in die hochglänzende Modewelt. Aber da ist die Normalität der Familie, der Ehefrau, die ihm Briefe und Rechnungen vorliest, die ihm den Telefonhörer hinhält, damit er seinen Vater sprechen hört, die sogar den Hörer hält, während seine Geliebte anruft, die Normalität der drei Kinder, die singen und tanzen und Bilder malen, die um sein Bett und um seinen Rollstuhl herum spielen, als wäre all das normal. Wunderbar. Wie macht man das?
Ich hoffe, ich finde mich da hinein.