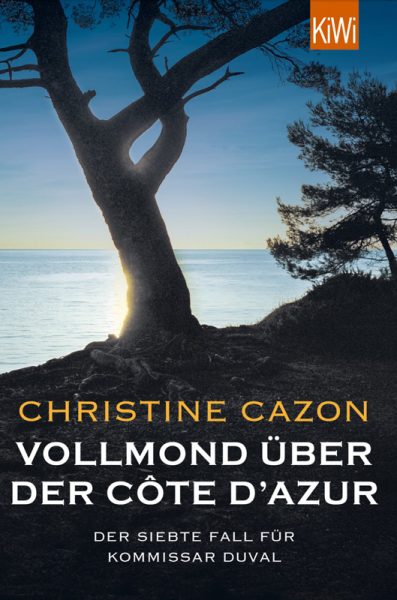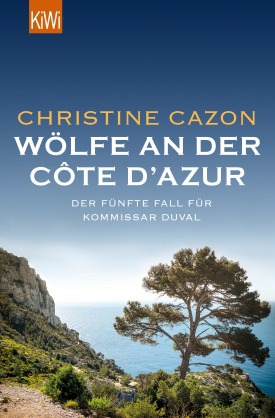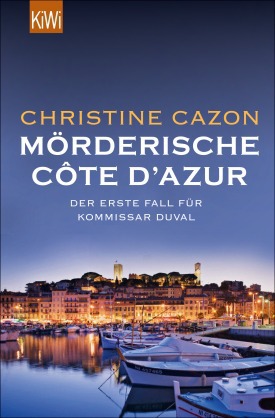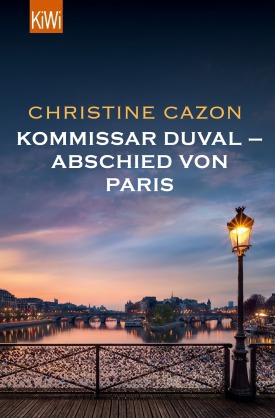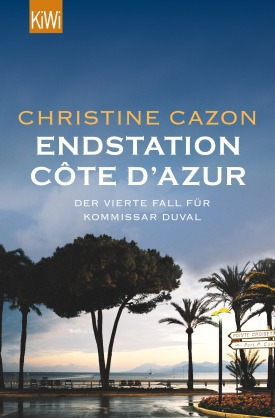Ich weiß nicht, ob ihr Veras Koreablog lest, aber da tun sich zur Zeit unglaubliche Dinge. Sie hat ein Buch aus ihrem blog gemacht, wie manch andere(r) auch und steht jetzt im Kreuzfeuer der koreanischen Kritik. Ich habe das Buch gelesen…
![]()
einfach um zu wissen, um was es geht, aber es ist egal, ob ich das Buch lustig, langweilig oder kritisch finde, interessant ist die Tatsache, dass sie in Ihrem Buch Kritik an Korea übt, schon ausreicht, dass man sie überall wüst beschimpft. Keine Kritik an Korea, schon gar nicht von einer Ausländerin.
Das kann man gewiss verallgemeinern. Hat ein Ausländer das Recht in einem fremden Land Kritik zu üben? Vermutlich nicht. Mit Nationalstolz geschwellter Brust lässt sich auch der Franzose schon gleich gar nichts sagen. Sätze wie “In Deutschland ist das aber so…” werden einfach nicht gern gehört und über Frankreich sage man bitte nur Gutes! Und ich denke, das ist überall so. Außer vielleicht in Deutschland: Wir mit unserer jüngsten Vergangenheit, noch immer schuldig und gramgebeugt, sind immer gleich eingeschüchtert und wir kritisieren uns fleißig selbst, noch bevor irgendjemand von außen etwas gesagt hat. Und Nationalstolz hat bei uns gleich einen faden Beigeschmack mit Arm heben undsoweiter.
Seit ich in Frankreich lebe habe ich die stereotype Kritik an uns Deutschen mit der ich hier ständig konfrontiert werde, aber auch ein bisschen satt, bei aller Selbstgeißelung, zu der ich auch neige, und ich würde mich heute auch nicht mehr gerne in Deutschland von Ausländern kritisieren lassen. Mann, so ist da hier, so essen wir, so leben wir und so reden wir eben und wenn’s dir nicht passt, dann geh nach Hause. Ich bin erstaunlich bewusst Deutsche, seit ich in Frankreich lebe, auch wenn ich mich hier doll anpasse und versuche a la française zu leben. Und es ist ein bisschen so, wie ein paar Koreaner in Veras Blog sagen, wenn schon Kritik an Korea, dann von Koreanern. Also, wenn schon jemand Deutschland kritisieren darf, dann bitte ich. Oder meinetwegen andere Deutsche.
Mein Buch über Frankreich wird von Deutschen, so weit ich das beurteilen kann, gerne gelesen, ein Kritiker bei amazon verstieg sich kürzlich soweit, zu sagen „dieses Buch macht glücklich“. Das zu lesen, macht mich wiederum ziemlich glücklich. Die Franzosen sehen das vielleicht nicht ganz so, vor allem nicht die in meiner direkten Umgebung. Von Paris aus lesen sich die netten Geschichten der kauzigen Dorfbewohner auch wieder anders. Man ist ja nicht betroffen.
Eine Französin, die, dank einiger Jahre Deutschlanderfahrung, mein Buch lesen konnte und es hier in einem literarischen Lesekränzchen auszugsweise den anwesenden Dorfbewohnern vorstellte, findet trotz allen Wissens um die Direktheit der Deutschen meinen Stil „cru“, das heißt sehr direkt, knallhart, kritisch – und sie sagte, wenn auch lachend, „ich fragte mich beim Lesen die ganze Zeit, warum sie nicht ihren Rucksack nimmt und wieder nach Hause fährt“. Ups, das saß. Anscheinend macht mein Buch sie nicht glücklich. Tatsächlich hatte ich nachts einen Alptraum, in dem sie mir freundlich aber bestimmt sagte, ich müsse Frankreich sofort verlassen. Das hat mich wirklich ein paar Tage umgetrieben, und ich habe Angst, dass eines Tages die Zweitwohnsitzler erfahren, dass ich sie nicht mag und dass ich mich im Buch kritisch äußere und dass sie mich lynchen werden oder erst mal zur Abschreckung nur meine Katzen. Ich habe das Buch bislang noch nicht an „meine Hoffamilie“ gegeben, weil ich Angst habe, dass sie mir übel nehmen, dass ich öffentlich geschrieben habe, der Hof sei schlampig, auch wenn ich dem noch so viel Positives entgegensetze.
Gerade habe ich das Buch von Nathalie Licard gelesen, die eine Zeitlang in der Harald-Schmidt-Show auftrat, als Stimme, als Frankreichkorrespondentin, als unfreiwillig komische Persönlichkeit. Ich bin bekennender Harald-Schmidt-Fan und die Zeit mit Nathalie habe ich noch in Erinnerung, außerdem traf ich Nathalie mal auf einem privaten Fest in der Kölner Südstadt, wo sie allerdings mit den anwesenden Franzosen rumwitzelte, und wenn man kein ausreichendes Französisch sprach, kam man nicht richtig rein in die ausgelassene Gruppe.
Nathalie schreibt von ihrem Alltag in Deutschland, ein bisschen schräg, ich finds lustig, vielleicht auch, weil ich die Art zu sprechen nachvollziehen kann. Aber sie änderte nicht mal die Namen ihrer Freunde – ob das für alle gilt, weiß ich nicht, aber ein paar habe ich namentlich wiedererkannt, hopste ich doch eine Zeitlang in der gleichen WDR-Deutschlandfunk-und-Verlags-Szene herum. Wie macht sie das? Nimmt ihr das keiner übel?
Ich habe in meinem Buch wenigstens alle Namen geändert – die Leute hier können natürlich ahnen, von wem ich schreibe, oder sie wissen es auch, aber außerhalb des Tales bin ich hoffentlich sicher. Mich macht das alles nervös, denn es wird immer enger, meine Familie, meine Schwiegerfamilie, meine Freunde, deutsche Verwandte von Dorfbewohnern, Ex-Kollegen, alle lesen mit. Worüber kann ich schreiben, wen und was darf ich noch kritisieren? Wie machen das professionelle Autoren? Ich habe mal gekuckt, Harald Martenstein schrieb kürzlich über Mainz und Wiesbaden und jetzt gerade über seine Katze. Bald schreibe ich vermutlich auch nur noch unverfängliche Geschichten über das Wetter und meine Katzen.
Oder ich lege mir ein Pseudonym zu. Das hätte ich vielleicht von Anfang an machen sollen.
Ich habe angefangen ein literarisches Bulletin für eine Internetseite zu übersetzen, das bzw. die von einem kleinen Kreis Krimiverrückter Menschen herausgegeben und unterhalten wird (http://www.polarophile.com), sie beschäftigen sich viel mit den Pseudonymen und anderen Masken der (Krimi-)Schriftsteller. Der Herausgeber ist geradezu besessen von der Idee, herauszukriegen, wer hinter welchem Namen steckt. Ist ja auch interessant, es gibt ein Beispiel, das mich wirklich beeindruckt hat, es ist die Geschichte von Romain Gary bzw. seinem Pseudonym Emile Ajar. Wer das schon kennt, kann jetzt die nächsten Sätze überspringen. Romain Gary war ein anerkannter Schriftsteller in Frankreich, der in den fünfziger Jahren einmal den Prix Goncourt gewonnen hatte. Irgendwann hatte er das Gefühl, die Literaturkritik nähme ihn nicht mehr wahr, und er schrieb einen Roman unter dem Pseudonym Emile Ajar, den er in einem komplizierten Szenario geheimnisvoll über einen Freund an einen südamerikanischen Verlag lancierte und vorgab inkognito bleiben zu wollen. Das Buch wurde verlegt, wurde erfolgreich und der neuentdeckte Autor Emile Ajar bekam den Prix Goncourt. Emile Ajar wurde berühmt, Gary musste seinem Pseudonym Gestalt geben und wählte dafür seinen Neffen aus, der sich als exzentrischer Schriftsteller aufspielte. Gary wuchs diese ganze Geschichte bald über den Kopf und er wurde eifersüchtig auf sein von ihm erfundenes Pseudonym. Er versuchte wieder unter seinem Namen zu schreiben, wurde aber weiterhin nicht wahrgenommen, und als er versuchte in dem Stil zu schreiben wie er es unter dem Pseudonym tat, wurde er als Plagiator von der Kritik verrissen. Die Absurdität dieser Geschichte ließ ihn wahnsinnig werden, er nahm sich 1980 das Leben – aufgedeckt hat er den Schwindel in seinem Testament nach seinem Tod.
Nun ich will nicht wahnsinnig werden, aber ich will die Freiheit, zu schreiben, was ich will.
Ohne, dass ich auf alle Empfindlichkeiten der Welt Rücksicht nehmen muss.
Ich denke noch über einen Namen nach…