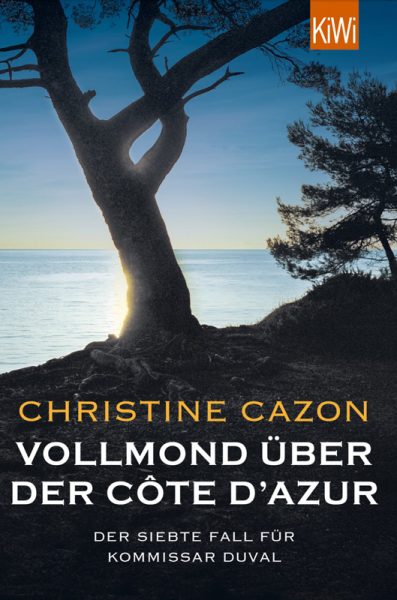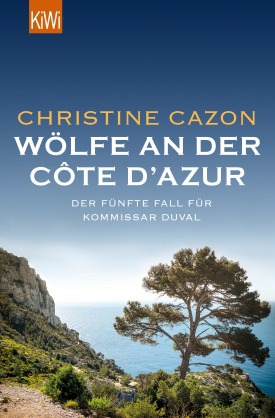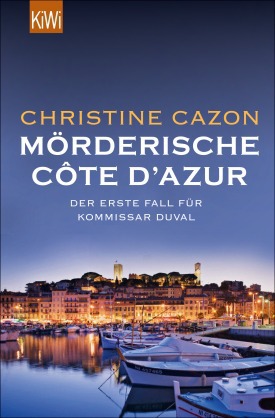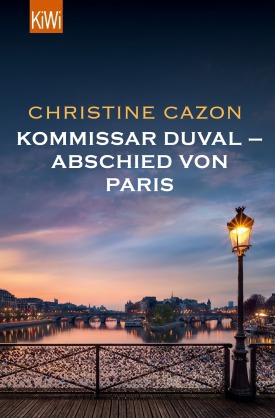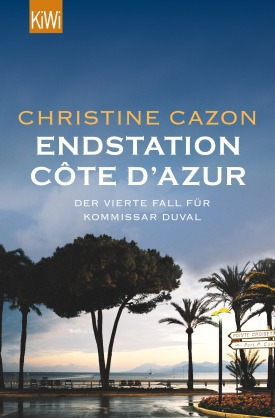Das erste Mal bewusst fremd fühlte ich mich, als wir von der hessischen Kleinstadt (aber immerhin neben der Großstadt) in ein Dorf im vorderen Odenwald gezogen sind. Knapp dreihundert Einwohner damals, unsere Telefonnummer hatte nur drei Stellen, ich kann sie noch immer auswendig. Ein Jahr lang ging ich im Nachbardorf in eine nageleue sogenannte Mittelpunktschule, die die Zwergschulen in den einzelnen Dörfern ersetzt hatte. Dort wurde ich bestaunt wie ein alien. Ich war irgendwie anders und sprach außerdem Hochdeutsch. Die Kinder lachten mich aus, weil ich sie nicht verstand. Für sie war es ein Spaß, mich Zungenbrecher im Dialekt nachsprechen zu lassen: “Gieß’ dein’ Kaktus sonst verderrterder!” oder “Wouerrroudnouel”, Wagenradnagel, ein Wort das ja stets präsent ist im Wortschatz Elfjähriger. Ich habe mich nach Kräften bemüht, diesen Dialekt zu lernen, um dazuzugehören, aber ich blieb doch fremd. Alles war hier ein bisschen anders. Die Mädchen meiner Klasse hüpften während der Pause nicht mehr Gummitwist, sondern liefen schon sehr erwachsen Arm in Arm plaudernd über den Schulhof und scherzten sogar mit dem Aufsichtführenden Lehrer, etwas, was mir im Traum nicht eingefallen wäre. Und ängstlich und staunend nahm ich an meiner ersten Klassenparty im verdunkelten Raum teil, und Jungens und Mädchen tanzten hier schon eng zusammen, weia!
Da ich gleich darauf in “der Stadt” aufs Gymnasium ging, und nicht wie alle anderen auf die Gesamtschule, entglitten mir die gerade gefundenen Freundinnen und das Dorfleben wieder. Ich wanderte zwischen zwei Welten. Morgens fuhr ich mit dem Bus in “die Stadt” und nachmittags kaufte ich im Tante-Emma-Laden des Dorfes bei der Hendelsch’ Rosa “Grüne Schmidt-Äpfel” ein und versuchte eine diplomatische Antwort auf die Frage, ob ich “die guuhde orrer die billisch’ Budder” wollte. Es dauerte Stunden, vor allem, wenn noch ein oder zwei Kundinnen vor mir dran waren. Abends holte ich Milch in einer kleinen blauen Plastikmilchkanne direkt beim Bauern. Die Fliegen dort im Stall und manchmal in der Milchkanne schreckten mich und auch das Ambiente des kleinen Ladens konnte ich nicht schätzen und war unendlich erleichtert als im Nachbarort ein Supermarkt eröffnet wurde. Der kleine Laden der rotbackigen runden Rosa Hahn verschwand alsbald. Mir fehlte er nicht.
Ich fühlte mich fremd im Dorf, obwohl ich den Dialekt nun verstand und im Zweifelsfall auch (annähernd) sprach, und obwohl ich zeitweise dort Handball im Verein spielte (es gab nichts anderes). Aber keinesfalls lief ich bei Dorffesten als Ehrenjungfrau im hellblauen Kleid mit Schärpe in der Parade mit, und natürlich tanzte ich abends im Festzelt auch nicht Discofox mit irgendwelchen Jungs, die mit Mokicks aus Nachbardörfern gekommen waren. Ich stand immer nur ein wenig fremd herum und sah zu. Die Fremdheit verstärkte sich, als die Dorffreundinnen sich mit achtzehn Jahren verlobten, wilde Polterabende in der Garage feierten und alsbald ein Haus auf dem Acker der Schwiegereltern bauten.
Außerdem war ich katholisch im evangelisch dominierten Südhessen. Wie peinlich diese Fronleichnamsprozessionen, wo die Nicht-Katholiken uns wie einen Karnevalszug begafften. Auch in der Kleinstadt, in der wir vorher gelebt hatten, gab es nicht viele Katholiken, aber hier war Diaspora und die vereinzelten Gläubigen wurden sonntags mit VW-Bussen aus den umliegenden Dörfern abgeholt, damit für die Messe überhaupt ein paar Menschen zusammenkamen. Ein paar alte Frauen kamen den kilometerlangen Weg zur Kirche auch unverdrossen und bei jedem Wetter zu Fuß gelaufen. Sie waren altmodisch angezogen, trugen Kopftücher und sprachen ein bisschen komisch. “Des sinn die Flichtling”, wurde mir erklärt. Auch dreißig Jahre nach Kriegsende waren die Familien, die aus dem Osten gekommen waren, und deren Namen häufig auf ein eingedeutschtes “tscheck” endeten, noch immer die “Flüchtlinge”. Wir wären heute vielleicht auch immer noch die “Zugezogenen”, wenn wir noch dort leben würden.
Vielleicht war das der Anfang, ich weiß es nicht, vielleicht hätte ich das Anderssein, das Fremdsein auch irgendwann gespürt, wenn wir am gleichen Ort geblieben wären, aber seither bin ich mir dessen bewusst. Ich war anders als die Dorffreundinnen, aber auch anders als die Stadtfreundinnen und wollte auch später weder eine Familie gründen noch ein Haus haben, und ich fühlte mich fremd als alle um mich herum sesshaft wurden. Also ging ich weg. Zunächst ging ich nur ein bisschen weg, wie Birgit Vanderbeke sagen würde. Aber stetig. Im Schnitt lebte ich alle drei Jahre woanders, arbeitete woanders und hatte eine neue Beziehung. Und selten alles an einem Ort. Das Unterwegssein als Lebensform. Weggehen und Neuanfangen konnte ich gut. Bleiben konnte ich nicht. Und dann ging ich “richtig” weg. Und heute sage ich, das war meine Rettung, obwohl es sich anfangs nicht so anfühlte. Nicht gleich zumindest. Aber diese körperliche Arbeit auf dem abgelegenen Hof in den Bergen und dort mit den Füßen abwechselnd in aufgeweichtem Matsch oder trockenhartem Lehm zu stehen, hat mich, wie es so schön heißt “geerdet”. Obwohl dieses harte, karge und schmutzige Leben anfangs wirklich ein Schock war. Die Tiere. Die Gerüche. Und diese Fliegen überall. Alles so fremd. Und die Sprache. Und wie die Menschen miteinander umgehen. Ich wurde auch hier angestaunt wie ein alien und war eingeschüchtert und fühlte mich fremder als je zuvor. Aber vielleicht hat mich dieses komplette Fremdsein befreit. Es war, als müsste ich alles neu lernen und als dürfte ich plötzlich auch Sachen ausprobieren. Und wenn man das Leben anders lebte? Manchmal stellt man ein Bild ja auch auf den Kopf, einfach um zu sehen, wie es auch sein kann. Manchmal ist es auf den Kopf gestellt sogar besser, intensiver.
Und dadurch, dass der Hof so abgelegen war (und ist) und ich mich mit den schrottreifen Hof-Autos auf den steilen Serpentinensträßchen lange nichtmal ins nächste Dorf traute, habe ich Dableiben gelernt. Und Sehen und Fühlen und Riechen und in die Tiefe gehen. So habe ich mich ganz langsam auf das Leben dort und vielleicht auf das Leben überhaupt eingelassen. Und auf die Menschen. Die Menschen, die ich in den Bergen getroffen habe, waren meist gut zu mir und neugierig und hilfsbereit. Dafür bin ich wirklich dankbar, denn es ist anstrengend, sich in einem anderen Land zurechtzufinden. Es ist anstrengend und es bleibt anstrengend, zumindest wenn man mehr will als Café au lait und Croissants in der Bar Tabac.
Jetzt lebe ich in Cannes, und das Fremdsein hat sich hier zu meiner großen Überraschung noch einmal verstärkt. Es ist sehr schwierig in Cannes wirklich anzukommen. In den Auswandererserien, die ich immer mal wieder schaue, heißt es oft “es hat in dem anderen Land niemand auf einen gewartet”. Im Klartext heißt das, es geht den Menschen am A*** vorbei, dass man da ist. On s’en fiche, würde der Franzose sagen, uns doch egal. Débrouille-toi, oder etwas vulgärer démerde-toi. Schau zu wie du klar kommst. War ich in den Bergen lange Christjann, l’allemande, was mich manchmal ärgerte, diesen Zusatz “die Deutsche” zu bekommen, so bin ich in Cannes gar niemand mehr. Viel zu viele Touristen und Fremde sind hier. Eine mehr? On s’en fiche. In einem Text, den ich vor drei Jahren für eine Anthologie schrieb, behauptete ich, bis man hier wirklich dazugehören würde, vergingen mindestes drei Jahre. Zwischenzeitlich dachte ich, nein, stimmt nicht, erst jetzt nach fünf Jahren in Cannes spüre ich ein leichtes Dazugehören, aber gerade erlebe ich einen Rückschlag und sage einschränkend: nicht überall. Umso schöner, wenn ich in mein Bergdorf zurückkehre für ein Fest, eine Einladung, was auch immer. Es ist herzerwärmend, wie die Menschen sich freuen, mich wiederzusehen und ich bin umso glücklicher als sich für mich letztes Wochenende dort alles richtig anfühlte und ich mich so gar nicht fremd fühlte. Ich sitze mit auf dem Dorfplatz und ich gehöre dazu. Und ich bin sicher, eines Tages werde ich Cannes den Rücken kehren und wieder in die Berge ziehen.
Seit zehn Jahren lebe ich in Frankreich. Fremd bin ich immer noch, mal spüre ich es mehr, mal weniger, aber es ist immer da, schon weil ich die Sprache nicht so leicht und selbstverständlich spreche wie meine Muttersprache und daher in vielen Situationen schweige und mich zurücknehme. Aber ich lebe in Frankreich. Ich lebe. Und ich muss nirgendwoanders mehr hin.
——————————————————————————————————
Dies ist ein Beitrag für die Blogparade “Ich war fremd” ausgerufen von Friederike vom Landlebenblog.