Heute ist der Fünfte und Tagebuchbloggen ist angesagt, Dank für Idee und Ausführung von WMDEDGT (kurz für: Was machst du eigentlich den ganzen Tag) geht an Frau Brüllen, die ich leider gerade nicht verlinken kann (irgendwas spinnt in meinem Programm, wir versuchen das zu lösen). Los gehts. Um halb Acht werde ich wach. ich habe gestern noch bis spät in die Nacht Europa 24 auf Arte geschaut und bin jetzt entsprechend unausgeschlafen. Ein halbes Stündchen kuschele ich mich an Monsieur, der, nachdem er frühmorgens Geschirr gespült hat, nochmal unter die Decke gekrochen ist. Er ist aber viel wacher als ich und würde gern schon reden. Ich nicht.
Um Acht stehe ich auf und mache mir Grüntee und Obsalat mit Müsli. Fast ein Jahr lang hat mir Monsieur morgens Kaffee und Rührkuchen ans Bett gebracht, damit ich in Ruhe wach werden kann. Es war sehr toll. Ich fühlte mich jeden Morgen wie eine Königin. Ich versuche es, aus Gründen, mal wieder ohne Kaffee, und die komplizierte Tee und Obstsalatvariante will Monsieur sich nicht merken. Also meditiere ich mich beim Obstschnippeln wach. Danach frühstücke ich und Pepita schnurrt auf meinen Knien. Ich mache Monsieur Andeutungen, die er richtig versteht und ohne viel Gebrüll und Drama bekommt das Kätzchen sein Antiflohmittel in den Nacken gerieben. Danach ist es trotzdem gekränkt. Pepita hat den beleidigten “Man kann niemandem mehr vertrauen”-Blick. Ich lese ein bisschen im Internet herum. Im Bergdorf hat es geschneit. Bei uns hats nur gewittert und geschüttet und es ist kalt geworden. Die Wäsche von gestern, abends schon fast trocken, ist wieder klitschnass und das Leintuch schleift schwer auf dem Terrassenboden. Wir werden es nochmal waschen.
Um neun gehe ich ins Bad. Monsieur, morgens schon viel dynamischer, werkelt im Haus herum. Um halb zehn bügele ich ein T-Shirt trocken, das ich anziehen will und außerdem zwei Vorhänge. Um zehn Uhr bin ich angezogen und frisch geföhnt und sitze bereits am Schreibtisch und… prokrastiniere, um hier zu schreiben.
Man sollte das (berufliche) Schreiben wie eine Liebesaffaire ansehen, habe ich neulich irgendwo gelesen. Wenn man eine heimliche Affaire hätte, würde man in jeder freien Sekunde mal hier eine SMS mal dort eine Mail tippen. Fiebrig, hellwach und intensiv. Diese Intensität solle man so für seine Arbeit einsetzen und mit fiebrigem Blick mal schnell zwei Sätze reinhauen. Ich starre auf den Bildschirm. Klappt nicht so ganz. Und dann doch.
Halb elf. Wir rufen die Schwiegermutter an, die gestern sagte, dass sie uns heute gerne ins Restaurant einladen will. Das heißt, sie will ausgehen. Ich war nicht begeistert. Es ist äußerst mühsam, sie von A nach B zu transportieren. Sie kann kaum noch laufen, ist halb verwirrt, was sie aber leider nicht liebenswürdiger gemacht hat, aber sie hat einen eisernen Willen. Sie kann natürlich alles noch selbst. Nein, sie braucht keine Hilfe. Wir erreichen Sie nicht, vermutlich hört sie das Telefon nicht, wir fahren direkt zu ihr und reservieren einen Tisch im Lieblingsrestaurant.
Nun, ich habe lange überlegt, ob ich das mit meiner Schwiegermutter hier so öffentlich machen soll, ich will sie nicht bloßstellen, will ihre Veränderung aber eigentlich schon lange dokumentieren und der Blog ist einfach eine gute Möglichkeit. Wenn Sie das zu privat finden und bevor Sie mir dazu kritische Mails schreiben, schlage ich vor, Sie lesen es nicht, sondern überspringen für dieses Mal bitte den Tagebucheintrag. Bitteschön. Sie wissen, worauf Sie sich einlassen.
Wir haben anderthalb Stunden eingeplant, eine Stunde, um sie fürs Ausgehen vorzubereiten, eine halbe Stunde für die Fahrt. Ihre Wohnungstür steht weit offen. Sie schläft, angezogen aber zusätzlich im Morgenmantel auf dem Diwan im Wohnzimmer und ist überrascht, uns zu sehen. Es dauert einen Moment, bis sie sich zurechtgefunden hat. Möchtet ihr einen Kaffee? fragt sie als perfekte Gastgeberin. Wir lehnen ab. Ob sie mit uns Essen gehen möchte? Gerne, sagt sie und freut sich. Sie hat eine Tasse Suppe gefrühstückt, erzählt sie uns. Suppe? Ja Suppe. Vermutlich hat schon wieder “jemand” ihr eigentliches Frühstück aufgegessen. Das kommt immer häufiger vor. Es sind schon einmal “sechs Personen” vor ihr in der Küche gewesen! Sie räkelt sich auf dem Diwan. Essengehen wäre schön, nur, wendet sie dann ein, die Krankenschwester, die ihr die Medikamente gibt und sie duscht und anzieht, war noch nicht da. Außerdem ist es auf dem Diwan im Morgenmantel gerade so schön warm und draußen sieht es nicht so gut aus. Wir wollen die Krankenschwester anrufen, um zu hören, wo sie ist, und um sie eventuell abzubestellen. Wir suchen das Telefon. Es findet sich in der kleinen Papiertüte, in der meine Schwiegermutter gerade alles Wichtige aufbewahrt. Wir finden darin auch das Mobiltelefon. Es blinkt grün und rot. “Sieht so aus, als habe jemand angerufen”, sagt sie und betrachtet meditativ das Blinklicht, schafft es aber nicht, das Telefon zu öffnen. Ich öffne das Telefon für Sie. Tatsächlich haben wir angerufen (grünes Blinken). Und der Akku ist fast leer (rotes Blinken). “Sie müssen es aufladen!”, sage ich, “der Akku ist fast leer, deswegen blinkt es rot!” “Nein!” Sagt sie entschieden und lächelt mich schlau an. “Niemals.” “Naja”, sage ich. “Es wäre schon besser, es ist gleich leer, schauen Sie”, und ich zeige ihr das leere Batteriesymbol.” “Nein”, sie schüttelt wieder den Kopf. Ich zucke mit den Achseln. “Da muss man nur hier irgendwo was reinstecken”, sagt sie und dreht das Telefon in alle Richtungen. “Genau”, sage ich, “das meine ich.” Monsieur nimmt kurzerhand das Telefon und steckt es an das Ladekabel des Akkus auf der Kommode im Eingang. In der Zwischenzeit ist die Krankenschwester, die wir noch nicht angerufen haben, gekommen. Sie macht “die Toilette” mit meine Schwiegermutter, wäscht sie, zieht ihr ein neues T-Shirt an, frisiert sie und gibt ihr die Medikamente. Das alles in flotten 15 Minuten. Ich ziehe derweil die Decken auf dem Diwan glatt, schüttele die Kissen auf und finde dahinter Geldscheine, Kekskrümel, Stofftaschentücher und eine Handtasche. Ich lasse, bis auf die Krümel, alles da, wo es ist. Danach muss meine Schwiegermutter sich erst mal wieder auf dem Diwan ausruhen. Wir ziehen ihr die Schuhe an, suchen eine mittelwarme Jacke, ein nicht zu dickes Kissen. “Müssen Sie nochmal auf Toilette, bevor wir losgehen?”, wage ich zu fragen. “Pardon?”, fragt Sie zurück. “Toilette”, wiederhole ich fragend. Sie lächelt ein bisschen überheblich. Ne vous inquietez pas pour moi! Das ist ihr Standardsatz, wenn Sie etwas höflich ablehnt, manchmal sagt sie es auch, wenn sie etwas nicht versteht. Machen sie sich um mich keine Sorgen. Nun gut. Wir beraten, was aus der Papiertüte vorübergehend in die Handtasche zum Ausgehen umgelagert werden kann (Geld, Scheckkarte) Sie zieht einen Umschlag nach dem anderen aus der Papiertasche, schaut hinein und überlegt. “Maman”, sagt Monsieur, “wir warten auf dich.” Entschlossen nimmt sie Papiertüte und versteckt sie hinter einem Sofakissen. Zerrt hinter dem anderen Sofakissen die Handtasche hervor, öffnet sie, und hier jetzt das gleiche Spiel. Alles wird herausgezogen und angeschaut. “Maman”, sagt Monsieur, “wir wollen los.” “Frag du mal wegen Toilette”, sage ich leise. “Bei mir findet sie das unschicklich.” “Musst du nochmal auf Toilette, Maman?” Entschiedenes Oui! Na klar. Nun, auch das dauert. “Ich fahr schon mal den Wagen vor”, sage ich, aber niemand außer mir findet den Satz witzig. Ich sage es natürlich auf französisch und vielleicht sagt Harry es in dieser Sprache anders, vielleicht ist Derrick in Frankreich auch nur einfach nicht so kultig (vor allem nicht in der Generation Monsieurs und meiner Schwiegermutter). Ich fahre das Auto in die Wohnanlage und stelle mich direkt vor die Eingangstür. Sie kommen in Zeitlupe. Während ich ihr helfe, ins Auto einzusteigen, muss Monsieur nochmal mit unserem Schlüssel hoch, um die Wohnung abzuschließen, den Schlüssel der Schwiegermutter haben sie nicht gefunden. Wir fahren los und meine Schwiegermutter ist so vergnügt, wie sie eben sein kann. Wo fahren wir hin? Théoule. Théoule? Ja, Théoule. Wir kommen an. Die drei Meter und zwei Stufen, die es zu überwinden gilt, um ins Restaurant zu gelangen, sind beschwerlich, aber keinesfalls würde meine Schwiegermutter außerhalb ihrer vier Wände einen Rollator, déambulateur heißt das hier, verwenden. Sie sitzt, den Rücken an das Kissen gelehnt und ist zufrieden. “Wir waren lange nicht mehr hier”, sagt sie. “Da ist ein neues Haus”, stellt sie beim Blick aus dem Fenster fest. “Was ist das? Ein Krankenhaus?” “Das steht da schon immer”, meint Monsieur. “Das ist ein Wohnhaus.” Es gibt ein Gläschen Champagner und geröstete Brotscheiben mit einem Töpfchen hausgemachter Tapenade. Das Brot ist zu hart. Sie hat vor kurzem eine Brücke mit vier Zähnen verloren und kann nicht mehr gut kauen. Letzte Woche war sie beim Zahnarzt, bekommt den Ersatz aber erst nächste Woche. Ich hole ihr das Weiche aus den Weißbrotscheiben, die man uns freundlicherweise auch hingestellt hat und gebe ihr etwas von der Tapenade darauf. “Wir haben hier doch mal dieses Picknick am Strand gemacht, erinnerst du dich?”, fragt sie Monsieur. “Welches Picknick?” “Na mit Fernand.” “Mit Fernand? Maman, das ist über fünfzig Jahre her!” Aber was sind schon fünfzig Jahre. Meine Schwiegermutter erinnert sich peu à peu an ganz viele Dinge. Ein Schiff, das Hotel und Restaurant war, zum Beispiel. An die Eisenbahnbrücke, die bei der Befreiung bombardiert wurde. Alles schon eine Weile her. Nur das Gebäude vor dem Fenster, das ist neu. “Was ist das für ein Gebäude?”, fragt sie wieder. “Ich habe das noch nie gesehen. Ein Collège?” Wir fragen diesmal vorsichtshalber die Bedienung. Ein Wohnhaus. Steht da schon immer. Aha. Monsieur fragt seine Mutter leichtsinnigerweise nach einer bestimmten Familie. Wie habt ihr euch kennengelernt? Meine Schwiegermutter denkt nach. Sie vergisst darüber das Essen, das ohnehin schwierig zu bewältigen ist. Für mich ist es nicht leicht zu ertragen, diese alte Dame, die solchen Wert auf Manieren und Tischsitten legt, essen zu sehen wie ein Kleinkind. Das mit der Gabel ist manchmal so schwierig und das, was letztlich im Mund landet, ist wenig. Dazu kommt, dass das Gemüse zu knackig ist, nicht weich genug, sie lutscht darauf herum und nimmt alles nacheinander mit den Händen wieder aus dem Mund und legt es auf den Teller zurück. Nur ein bisschen Fisch kommt wirklich im Magen an. Das alles geht in Zeitlupe. Eine Stunde etwa für den Hauptgang. Sie muss so viel nachdenken und holt immer mal eine Information zu besagter Familie aus ihren Hirnwindungen hervor. Einen Namen. “War der nicht Gendarm?”, fragt Monsieur. “Der war Chauffeur des Commissaires”, weiß Sie, wie aus der Pistole geschossen. Jetzt muss sie auf Toilette. “Das dauert hier alles so lang”, entschuldigt sie sich. Nur deswegen “muss” sie jetzt. Wir haben das Restaurant nicht nur gewählt, weil es unser Lieblingslokal ist, sondern weil dort dieses Örtchen ebenerdig und somit für sie gut erreichbar ist. Sie kann sich aber kaum noch erheben. Sie ächzt und stöhnt. Monsieur begleitet sie. “Schließ nicht ab”, sagt er warnend und wartet davor. Es dauert. Das Dessert wird serviert. “Alles in Ordnung Maman?”, höre ich Monsieur halblaut fragen. Sie antwortet nicht. “Maman?” Er klopft an die Tür. “Besetzt!”, schreit sie panisch auf. Die Leute im Lokal amüsieren sich leise. Monsieur kommt und geht, immer zwischen einem Häppchen Dessert und der besagten Tür hin und her. Maman? Letzen Endes öffnet er entschlossen die Tür und findet seine Mutter dort wie ein Häufchen Elend vor. Er muss ihr helfen die Hose wieder hoch- und anzuziehen. Sie hat es nicht mehr geschafft, sich so tief zu bücken. Zurück kommt sie kaum noch, plumpst erschöpft auf den Stuhl, freut sich aber über die Creme Brulée, denn die immerhin ist weich, süß und köstlich. Sie isst sie beinahe vollständig auf. Trinkt noch einen großen Schluck Wein und bestellt einen Kaffee. Zum Kaffee gibt es ein kleines Küchlein, aber es ist etwas trocken, so dass sie es, gute Französin, in den Kaffee tunken will. Leider plumpst es dabei komplett hinein. Sie ist erschrocken, ich tue so, als habe ich es nicht gesehen. Sie bewahrt die Contenance und rührt ein bisschen im Kaffee herum und holt später mit dem Löffel das aufgeweichte Küchlein wieder heraus. Auf dem Weg zum Mund plumpst es leider wieder zurück, es platscht in den Kaffee und hinterlässt Kaffeespuren auf dem Tisch und auf ihrem weißen Shirt. Normalerweise ist immer jemand anders schuld, wenn ihr etwas nicht gelingt. Im Zweifelsfall derjenige, der versucht zu helfen, damit eben nichts passiert. Weswegen niemand mehr hilft. Das ist ihr in der Regel ganz recht. Sie braucht niemanden!, wird sie nicht müde zu beteuern. “Naaaaiiiin” schreit sie immer wie ein trotziges Kind auf, wenn trotzdem jemand versucht, ihr ein Glas aus der zitternden Hand zu nehmen. Diesmal aber gibt es keinen anderen Schuldigen. Und es ist ihr peinlich. Noch peinlicher ist ihr, dass ich es gesehen habe. Und ich habe gesehen, dass Sie gesehen hat, das ich es gesehen habe. Wie unangenehm. “Wir gehen!” Entscheidet sie nun barsch. “Es hat alles viel zu lange gedauert hier. Frag mal nach der Rechnung”, fordert sie Monsieur auf. Monsieur erhebt sich und geht zahlen. Sie sucht in ihrer Tasche. “Wir können gehen”, sagt Monsieur. “Natürlich nicht, ich habe nicht bezahlt und ich finde meine Karte nicht”, sagt sie. “Ich habe schon bezahlt”, sagt Monsieur. “Mit meiner Karte?” “Nein mit meiner Karte.” “Dann gib mir meine Karte zurück!” “Ich habe deine Karte nicht, Maman. Wir haben sie vorhin bei dir nicht gefunden, deswegen habe ich gezahlt.” “Aber ICH wollte zahlen!” Sie ist verärgert. “Oui, Maman.” “Ich hol schon mal das Auto”, sage ich und ziehe mich aus dem Konfliktfeld zurück. Ich halte vor dem Restaurant. Der Weg zurück zum Auto (zwei Stufen, drei Meter) ist für sie sehr mühsam. Erschöpft sitzt sie irgendwann im Auto und ich höre sie zum ersten Mal sagen “Ich bin zu alt, ich kann das nicht mehr .” Es rührt mich. Dann aber sucht sie erneut in ihrer Handtasche, zieht jeden Zettel, jeden Umschlag mehrfach heraus und betrachtet ihn, sie findet ihre Kreditkarte nicht und wird böse: “Alle wühlen in meinen Sachen herum, deswegen finde ich nichts mehr. Du hast mit meiner Karte bezahlt!” “Nein”, sagt Monsieur. “Ich habe mit meiner Karte bezahlt.” “Dann gib mir jetzt meine Karte zurück!” “Ich habe deine Karte nicht, Maman. Die ist irgendwo zuhause, wir suchen sie dort.” Sie schimpft und schimpft und wird immer lauter. “Diese Manie, in meinen Sachen herumzuwühlen! Zusätzlich zu all denen, die meine Sachen verstecken und stehlen! Und jetzt hast du mir meine Karte weggenommen …” Alle Versuche, sie zu beruhigen und abzulenken (Maman, schau mal die schneebedeckten Berge! Schau mal die Kreuzfahrtschiffe! Schau mal das Meer!) schlagen fehl. Leider hat sie von der ganzen Strecke am Meer entlang nur das Innere ihrer Handtasche gesehen. Mit dem Kopf nach unten und in ihrer Tasche wühlend sitzt sie auch noch minutenlang, als wir vor ihrem Haus stehen. “Maman”, sagt Monsieur. “Verzeihen Sie, das Spektakel, das ich Ihnen gegeben habe. Ich bin zu alt, ich kann nicht mehr ausgehen”, sagt sie zum Abschied zu mir. Es rührt mich wieder. Seit Monaten denken wir bei jedem Ausgehen, es könnte das letzte Mal gewesen sein. Heute ist es vermutlich wirklich das letzte Mal gewesen. Monsieur begleitet sie nach oben. Dort suchen sie etwa eine halbe Stunde die von Monsieur “gestohlene” Kreditkarte. Ich bin froh, dass ich nicht dabei bin. Als wir aus der Wohnanlage hinausfahren wollen, fehlt uns der “Biep”, die Fernbedienung für das Tor. Sie lag vorne im Auto und vermutlich hat meine Schwiegermutter sie eingesteckt. Monsieur geht noch einmal zurück. Sie weigert sich, uns die Fernbedienung zu geben und klammert sich an ihre verschlossene Handtasche. Die Fernbedienung gehört ihr. Es ist ihre Wohnung und ihre Wohnanlage! Nun gut. Wir schaffen es trotzdem raus. Um 16 Uhr sind wir zuhause. Wir finden auf Anhieb einen Parkplatz, das haben wir auch verdient nach unserer heutigen BA, der bonne action, einer “guten Tat”. Dann aber suchen wir schon wieder, diesmal eine Luftpumpe für die Enkel, die mit dem Fahrrad loswollen, füttern die maunzende Pepita, danach sinken wir ins Bett zur Sieste. Ich döse nur, Monsieur aber schnarcht erschöpft. Um Viertel vor Fünf stehe ich auf und schreibe hier.
Monsieur sieht jetzt Tennis im Fernsehen. Seit Monaten kommt nur Tennis, scheint mir. Ich wollte eigentlich noch etwas anderes Schreiben, aber ich bin zu müde, keine Energie für meine “Liebesaffaire”. Ich hole die Wäsche rein, die jetzt trocken ist. Das Leintuch wandert gleich zurück zur Schmutzwäsche. Später werde ich noch etwas bügeln und dabei fernsehen. So war mein Tag. Danke fürs Lesen. Und die anderen Tagebuchblogger finden Sie wie immer hier





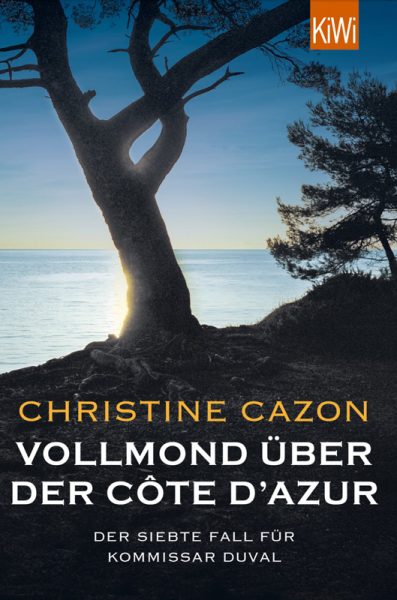

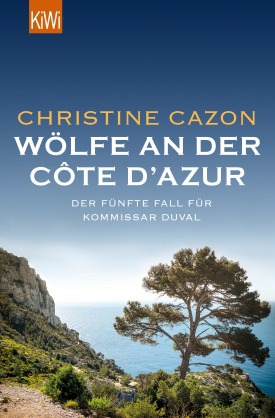
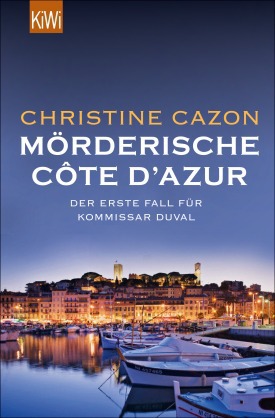


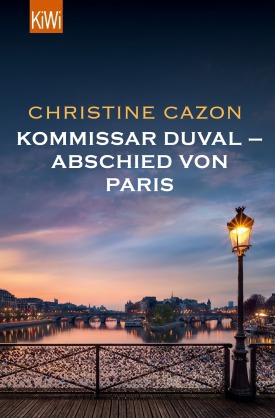
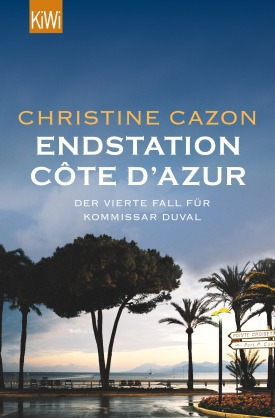
oh, wenn ich das lese, dann möchte ich dir und Monsieur gerne einen weiteren Sonntag schenken, einen, wo ihr irgendwo gemeinsam essen gehen könnt und deiner Schwiegermutter schenke ich einen Tag, an dem nix mühsam ist und nix fehlt und das Essen schmackhaft ist und der Keks nicht dank Schwerkraft dahin fällt, wo er nix zu suchen hat… kann ich aber leider nicht, also wünsche ich euch einen schönen Mai
Danke dir, meine liebe Vici! Ich weiß, ich kann euch auch nichts anderes wünschen. 💚
Wie sehr mich das an meine Mutter erinnert hat! Danke für die Beschreibung. Das Alter verlangt Jedem Alles ab. Und wenn es in dieser Zeit etwas zu Lachen gibt, das sind die Perlen die in der Erinnerung übrig bleiben. Ich wünsche Ihnen viel Kraft.
Dankeschön Kebi!
Ich habe geweint, als ich das las. Ich denke vor allem an Monsieur und wie er sich fühlen muss. Ich kennee das. Mein Vater erkrankte schleichend in seinen Siebzigern an Demenz, Alzheimer oder wie man es auch nennt. Am Ende, wenn ich ihn besucht, sprach er Französisch mit mir, weil wohl irgend etwas in ihm klingelte: Frankreich. Er sah mich an und sagte: und wie heißen Sie, Madame? Ich antwortete, ich heiße Caroline. Er antwortete: „ ich habe eine Tochter, die heißt auch Caroline“. Ich sagte: ich bin deine Tochter, Papa und er sah mich ziemlich irritiert und hilflos an. Manchmal abends wollte er unbedingt in die Stadt fahren und ließ keine Ruhe, bis ich nachts um drei mit ihm an die Bushaltestelle gehen mußte, aber erst, als kein Bus kam, ließ er sich ins Bett bringen. Er faßte sich oft an den Kopf und fragte verzweifelt, was ist da bloß los? Als er mit 92 starb, waren wir alle für ihn und uns erleichtert. Es ist furchtbar, wenn eine Person, die man als intelligente Respektperson kennt und liebt, nicht mehr ernst zu nehmen ist. Deshalb denke ich an deinen Mann. Er hat mein tiefes Mitgefühl
Dankeschön, Caro. Es ist deprimierend für ihn, seine Mutter schon so lange und so langsam “weniger” werdend zu erleben. Sie ist fast 99. Es kann jeden Tag zu Ende sein, es kann aber auch noch Jahre dauern. Sie ist (s)eine tägliche Sorge.
Oh wie tragisch, liebe Christiane. Das tut mir so leid für euch alle 😕. Dir – und besonders deinem Mann – wünsche ich viel Kraft und Geduld 🍀🍀🍀! Herzliche Grüße 🙋😘
Danke, liebe Uschi!
99 Jahre, was für ein biblisches Alter! Wie wir wohl sein und uns fühlen werden, wenn wir alt, so richtig alt sind? Dieser Gedanke geht mir durch den Kopf….Liebe Grüße nach Cannes, Tina
Und sie würde so gerne 100 werden oder noch älter … ich glaube, man selbst fühlt sich in jedem Alter immer noch “jung” (ich fühle mich ja auch mit Ende 50 noch nicht so alt, wie ich früher glaubte, dass sich die “Alten” fühlen würden). Es sind die anderen, die einem klar machen, dass man “alt” ist. Nur, dass man Vieles nicht mehr kann, ist vermutlich ernüchternd. Ich persönlich will gar nicht “so richtig alt” werden, wenn ich sehe, was es aus einem macht und ich hoffe, ich darf früher gehen. Liebe Grüße zurück!
Ich muss bei deinem Text so sehr an meinen Vater denken und wie schlimm es für ihn gewesen sein muss, als meine Mutter durch die Demenz ihre Persönlichkeit verlor. Wie sie ihn in ihren klaren Momenten immer wieder anflehte, sie nicht ins Heim zu geben. Und er eisern und ganz lange, und vor allem gegen jede Vernunft, versuchte, das ihr gegebene Versprechen “in guten wie in schlechten Tagen” zu halten. Wie er sich lange weigerte eine Pflegestufe für sie zu beantragen, weil damit das Unaussprechliche Realität wurde. Und er am Ende total erschöpft, schon vom Krebs gezeichnet, doch in eine Heimeinweisung einwilligte. Wie weh muss das getan haben.
Oh Karin, Danke! – danke Ihnen allen, die Sie mir (und uns) von Ihren (leidvollen) Erfahrungen mit demenzkranken Familienangehörigen berichten.
So ähnlich ist das hier auch. Wir versuchen meiner Schwiegermutter den Wunsch, dass sie bis zum Schluss in ihrer Wohnung bleiben kann, zu ermöglichen. Trotz Krankenschwestern und Personal bedeutet das auch für uns, Monsieur und seine Tochter vor allem, eine tägliche Präsenz. Es erschöpft uns alle.
Ein großartiger und berührender Film zum Thema, wenn man denn einen Film dazu sehen will, ist “Amour” (dt: Liebe) von Michael Haneke, der vor ein paar Jahren die Goldene Palme in Cannes bekommen hat. Hier habe ich darüber geschrieben. http://aufildesmots.biz/2012/05/die-goldene-palme/
Ein sehr tiefgehender und eigentlich leiser Film. Ich habe sehr weinen müssen, man fühlt sich als Betroffener noch stärker betroffen und angesprochen.
Ich habe auch die wahrscheinlich unrealistische Hoffnung, mal in meinen eigenen vier Wänden zu sterben. Ich könnte es mir irgendwie nicht anders vorstellen. Vielleicht ändert sich diese Sicht ja noch mit dem Alter?
Es heisst ja, eine Mutter kann vier Kinder (oder waren’s mehr?) ernähren, aber vier Kinder keine Mutter, oder so ähnlich. Es ist für unsere Generation in der Tat schwierig. Wir haben alle unsere eigenen Leben. Manche haben noch minderjährige Kinder, um die sie sich kümmern müssen und dann noch die alten Eltern. Und aus der Ferne ist es nochmal komplizierter. Ich schreibe dies sehr ungern: ich kann eigentlich erst richtig Urlaub machen und mich etwas von meinem stressigen Leben erholen seit meine Eltern tot sind. Und doch fehlen sie mir jeden Tag.
Ach Karin –
Und dass du trotzdem die Energie hast, so einen ausführlichen und einfühlsamen Text darüber zu schreiben. Toll!
Naja, es ist auch eine Art Verarbeitung – und ich wollte unseren Alltag mit ihr und ihre Veränderung schon lange dokumentieren. Der Blog ist ja wie mein Tagebuch. Es gab auch schon sehr viel unschönere Situationen, die ich aber nicht öffentlich erzählen möchte.
Liebe Christine, danke für diesen Beitrag – sehr einfühlsam und doch total realistisch. Ganz genau so erlebe ich es auch. Es ist so tröstlich zu sehen, dass man nicht die einzige ist, die mit diesem traurigen Problem befasst ist. . .