
Wir haben fünf Tage in einer Parallelwelt verbracht. In den Bergen sterben die Leut. Überhaupt sterben in und um Guillaumes, dem Zweihundert-Seelen- Dorf im oberen Vartal, in dem ich seinerzeit in der kleinen Cooperative, dem Genossenschaftsladen, gearbeitet habe, ziemlich viele Menschen, denen ich Futtermais, Gummistiefel oder Saatkartoffeln verkauft habe. Es tut mir weh, all die Menschen, die “meine Welt” dort oben ausmachen, verschwinden zu sehen. Besonders weh tut es, wenn es die Menschen aus “meinem” Dorf sind, Châteauneuf d’Entraunes, das noch kleiner ist und noch ein paar hundert Meter höher liegt. Vor zwei Monaten starb schon Rosette, eine Schäferin und eine besondere Persönlichkeit des Dörfchens. Vier wild aussehende Schäfer trugen ihren Sarg vom kleinen Dorfplatz, an dem ihr Haus steht, bis zur Kirche. Der Diakon, gleichzeitig der Landarzt und Freund der Familie sprach sehr persönlich und liebevoll von ihr und ihrer Familie, die ein stets offenes Haus führten. Bei ihnen sagt man “guten Tag” wenn man im Dorf ankommt und “Auf Wiedersehen” wenn man wieder geht. Fast alle Bewohner des Dorfes lassen ihren Schlüssel dort am riesigen Schlüsselbrett, für den Fall dass … Dieses Haus ist Dreh- und Angelpunkt des Dorfes. Hier gibt der Briefträger Post ab, die bei dem einen oder anderen nicht in den Briefkasten passt und liefert gleichzeitig die Neuigkeiten aus dem Tal. Nachrichtenzentrale. Alles weiß man hier. Im Winter ist es dort immer gut geheizt, häufig ist es so warm, dass ich mir sofort die Jacke vom Leib reiße und schwer atmend und mit hochrotem Kopf an der Tür stehen bleibe. Meistens aber wird man genötigt, sich zu setzen, etwas zu trinken, je nach Tageszeit einen Kaffee, einen Minzsirup oder einen Pastis, oder wenigstens zu erzählen, was es Neues gibt. Sucht man jemanden im Dorf, dann fragt man am besten hier nach. Entweder weiß man, wo der oder diejenige sich befindet, oder er oder sie ist sowieso gerade da und plaudert. Alle sind früher oder später hier. Es herrscht ein Kommen und Gehen. Alle reden durcheinander, Hunde und Katzen wuseln herum, der Fernseher läuft, das Telefon klingelt. Kommt man überraschend um die Mittagszeit, rücken sie auf dem engen Canapé zusammen, quetscht man sich dazwischen und wird mit verköstigt. Früher war es Rosette, die kochte, seit ein paar Jahren konnte sie es nicht mehr. Sie saß zusammengesunken mit dem kleinen Hund oder einer der Katzen auf dem Canapé und atmete nur noch mithilfe eines Sauerstoffgeräts. Ich erinnere mich noch an sie, wie sie früher war, rasant rothaarig und mit langen roten Fingernägeln, auf ihre Art sehr kokett und gleichzeitig brüsk. Besser war es, gut mit ihr auszukommen. Ich hatte die Ehre, dass sie mich mochte. Mir bot sie noch einen Platz an, als sie schon sehr müde war, auf dem Sofa nicht mehr saß, sondern lag und sich kaum noch erhob. Ihr Mann hatte mir gesagt, ich solle nach dem Essen bei Ihnen den obligatorischen Kaffee trinken. Bis ich aber kam, hatte er sich schon zur Sieste zurückgezogen. Sie leben in all dem Trubel doch ihren eigenen Rhythmus. “Setz dich”, sagte sie zu mir und richtete sich mühsam auf. “Willst du einen Kaffee?” Ich wehrte ab, sie insistierte. Der Kaffee war von ihrem Mann versprochen worden. Das hielt sie ein. Ich könne mir auch selbst einen Kaffee machen, schlug ich vor. Sie winkte nur ab und erhob sich langsam von ihrem Canapé, schlurfte zur Kaffeemaschine und ließ mir einen Espresso durchlaufen. Sie stellte das kleine Glas vor mich hin und suchte die Zuckerdose im Schrank. Dann ließ sie sich schwer atmend wieder auf das Canapé fallen und stöpselte sich an ihre Sauerstoffflasche an. “Nimm dir einen Keks” forderte mich Maria, ihre Mutter, auf, und machte eine Geste zur riesigen Suppenschüssel mit dem gesprungenen Deckel, in der immer Gebäck, im Winter selbst gebackenes Spritzgebäck, aufbewahrt wird. Ich nahm mir einen Keks, tunkte ihn in den Espresso und erzählte dies und das. Ein paar Tage später war Rosette so erschöpft, dass ihr Mann sie ins Krankenhaus fuhr. Sie wollte nicht. Niemand will hier ins Krankenhaus. Er fuhr sie trotzdem. Es war Freitag Abend. Im kleinen Regionalkrankenhaus eine Dreiviertelstunde entfernt sagten sie, dass sie vor Montag nichts machen könnten. Kein Arzt da. Was wollen Sie machen, wir sind auf dem Land. Ihr Mann fuhr sie noch eine weitere Dreiviertelstunde bis nach Nizza in die Notaufnahme eines Stadtkrankenhauses. Dort starb sie noch in derselben Nacht. Ihr Mann ist untröstlich, sie ausgerechnet in dieser Nacht verlassen und ihr nicht die Hand gehalten zu haben.

Und jetzt ist Maria gestorben. Sie war außer sich und blieb untröstlich, dass ihre Tochter vor ihr gegangen war. Maria. Sie war Schäferin mit Leib und Seele. Ziegen und Schafe waren ihr Leben. Sie war kaum in der Schule gewesen, konnte kaum lesen und schreiben, aber sie hatte ein anderes Wissen: Ein tiefes Wissen von Pflanzen und Tieren und dem Wetter, von der uns umgebenden Natur und von den Menschen. Sie hat ihr langes Leben lang gearbeitet und immer Tiere gehabt. In den letzten Jahren immer weniger, meistens päppelte sie nur noch die Schafe auf, die zu schwach waren, um bei der jährlichen Transhumance, dem Auftrieb der Schafe in die Berge, mitzulaufen. Alle paar Stunden gab sie ihnen die Flasche. Einmal habe ich ihr eines gebracht, das entkräftet am Straßenrand liegengeblieben war. Seine Mutter hatte es abgelehnt und es war fast verhungert. Als ich mit dem kleinen Schaf im Arm in die Küche kam, nickte sie nur und erhob sich. Dass das Schäfchen nach ein paar Wochen dennoch gestorben war, hat sie nie vergessen. Tiere sterben eben manchmal, sagte sie damals und zuckte mit den Schultern. Man kann nicht um jedes Tier weinen. Überhaupt wird hier nicht geweint. Das Leben in der Natur und mit Tieren ist hart. Ich riss mich damals zusammen und wischte mir nur verstohlen die Tränen aus den Augen. Vor ein paar Wochen sagte sie mir, sie habe vermutlich die Milch aus dem Milchpulver nicht nahrhaft genug gemacht. Bei all den zigtausend Schafen, die sie aufgezogen und gehütet hat, hat sie “mein” kleines Schaf, das nicht überlebt hat, nie vergessen. Überhaupt hat sie nie etwas vergessen. Sie kennt Monsieur noch aus dessen Kindertagen und fragte und erinnerte sich immer mal wieder an dieses und jenes, das über siebzig Jahre zurücklag. Eine Zeitlang waren Monsieurs Mutter, die Bankierstochter und Maria, die Schäferin, zwei Frauen, die kaum gegensätzlicher sein konnten, die beiden ältesten Damen des Dorfes. Beide strebten an, hundert Jahre alt werden zu wollen und erkundigten sich durchaus respektvoll immer wieder, wie alt denn nun die jeweils andere sei. Aber nur Maria hat die Hundert, gar die Hundertzwei erreicht. Kleiner Triumph am Ende eines Lebens.
Seit ich Maria kenne, hatte sie Schwierigkeiten zu laufen und ließ sich quasi von ihrer Motor-Schubkarre ziehen, mit der sie von einem Stück Garten zu einem Stück Wiese rumpelte, um hier Bohnen zu ernten und dort mit einer Sense Gras zu mähen für die Stallkaninchen. Die Sense diente ihr dabei gleichzeitig als Stütze. Sie konnte nicht nichts tun. Im Winter saß sie zwar bei gutem Wetter in der Sonne vor der Scheune, aber niemals war sie dabei untätig, sondern sie flocht mit ihren rheumatisch verformten Händen Körbe. Und später zog sie in einem auf Skiern montierten Waschkorb Holz für den Ofen aus der Scheune bis ins Haus. Erst die letzten Jahre, als ihre Beine sie nicht mehr trugen und sie ans Haus gefesselt war, hörte sie gezwungenermaßen auf zu arbeiten, und sie hörte nicht auf, darüber zu klagen. Sie sei zu nichts mehr nütze, meinte sie. Sie saß schwer auf ihrem Stuhl und wartete auf das Essen und darauf, dass man ihr die Neuigkeiten der Welt hineintrug in die überheizte Küche. Vor knapp zwei Wochen war sie trotz all der Pflege der Krankenschwestern, und vor allem trotz der aufopfernden Zuwendung von Cathy, der Haushaltshilfe, die so viel mehr war als nur eine Haushaltshilfe, und des Schwiegersohns (beide am Ende ihrer Kräfte) in einem so schlechten körperlichen Zustand, dass entschieden wurde, sie könne nicht mehr zu Hause bleiben und müsse ins Krankenhaus. Ich war an dem Tag anwesend und es war herzzerreißend. Sie wollte nicht und weinte laut und bitterlich. “L’hopital c’est la fin.” Das Krankenhaus ist das Ende. Wir alle weinten auch. Sie war bis zum Schluss hellwach im Kopf, aber ihr Körper war müde. Und der Kummer darüber, ihre Tochter verloren zu haben, hat ein Übriges getan.
Rosette und Maria sind nicht mehr unter uns, aber für immer in unseren Herzen. Rosette war unsere Trauzeugin. Und sie hat mich auch für eine meiner Romanfiguren inspiriert. Wir werden beide nie vergessen.

Nous avons passé cinq jours dans un monde différent. Dans les montagnes, les gens meurent. À Guillaumes, le village de deux cents âmes de la haute vallée du Var où je travaillais à l’époque dans la petite coopérative, les personnes à qui je vendais du maïs, du blé, des bottes en caoutchouc ou des semences de pommes de terre meurent. Cela me fait mal de voir disparaître toutes ces personnes qui ont été “mon monde” là-haut. Cela me fait particulièrement mal quand ce sont des gens de “mon” village, Châteauneuf d’Entraunes, qui est encore plus petit et qui se trouve encore quelques centaines de mètres plus haut. Il y a deux mois déjà, Rosette, une bergère et une personnalité particulière de ce petit village, est morte. Quatre bergers ont porté son cercueil depuis la petite place du village, où se trouve sa maison, jusqu’à l’église. Le diacre, qui était aussi le médecin de campagne et un ami de la famille, a parlé d’elle et de sa famille de manière très personnelle et affectueuse, car elle et sa famille tenaient une maison toujours ouverte. Chez eux, on dit “bonjour” en arrivant au village et “au revoir” en repartant. Presque tous les habitants du village laissent leurs clés sur l’immense tableau des clés, au cas où … Cette maison est le centre névralgique du village. C’est ici que le facteur dépose le courrier qui ne rentre pas dans la boîte aux lettres de l’un ou l’autre et qu’il livre en même temps les nouvelles de la vallée. C’est une centrale d’information. Tout se sait ici. En hiver, on est toujours au chaud, il fait souvent si chaud que j’arrache ma veste et que je reste à la porte, respirant difficilement avec la tête toute rouge. Mais la plupart du temps, on nous invite à s’asseoir, à boire quelque chose, selon le moment de la journée, un café, un sirop de menthe ou un pastis, ou au moins de raconter ce qu’il y a de nouveau. Si l’on cherche quelqu’un dans le village, le mieux est de demander ici. Soit on sait où se trouve la personne, soit elle est de toute façon là, en train de bavarder. Tout le monde est là tôt ou tard. Il y a des allées et venues. Tous parlent en même temps, les chiens et les chats s’agitent, la télévision est allumée, le téléphone sonne. Si l’on arrive par surprise à l’heure du déjeuner, ils se serrent sur l’étroit canapé, on se presse entre eux et on est aussi nourri. Avant, c’était Rosette qui faisait la cuisine, mais depuis quelques années, elle ne le pouvait plus. Elle s’asseyait sur le canapé avec le petit chien ou l’un des chats et ne respirait plus qu’à l’aide d’un appareil à oxygène. Je me souviens encore d’elle telle qu’elle était autrefois, rousse et avec de longs ongles rouges, à la fois très coquette et brusque à sa manière. Il valait mieux être en bons termes avec elle. J’ai eu l’honneur qu’elle m’appréciait. Elle m’a encore proposé une place alors qu’elle était déjà très fatiguée, qu’elle n’était plus assise, mais allongée sur le canapé et ne se levait presque plus. Son mari m’avait dit que je devais prendre le café obligatoire chez eux après le repas. Mais le temps que j’arrive, il s’était déjà retiré pour la sieste. Dans toute cette agitation, ils vivent tout de même à leur propre rythme. “Assieds-toi”, me dit-elle en se redressant péniblement. “Tu veux un café ?” J’ai refusé, elle a insisté. Le café avait été promis par son mari. Elle a tenu sa promesse. Je peux aussi me faire un café moi-même, ai-je suggéré. Elle se contenta d’un signe de la main et se leva lentement de son canapé, se traîna jusqu’à la machine à café et me fit passer un expresso. Elle posa le petit verre devant moi et chercha le sucrier dans l’armoire. Puis elle se laissa à nouveau tomber sur le canapé en respirant difficilement et se rebrancha sur sa bouteille d’oxygène. “Prends un biscuit” m’a demandé Maria, sa mère, en faisant un geste vers l’énorme bol de soupe au couvercle fêlé dans lequel sont toujours conservés des biscuits faits maison. J’ai pris un biscuit, je l’ai trempé dans l’expresso et j’ai raconté ceci et cela. Quelques jours plus tard, Rosette était si épuisée que son mari l’a conduite à l’hôpital. Elle ne voulait pas. Personne ne veut aller à l’hôpital ici. Il l’a quand même conduite. C’était vendredi soir. Dans le petit hôpital régional à trois quarts d’heure de là, ils ont dit qu’ils ne pouvaient rien faire avant lundi. Il n’y a pas de médecin. Que voulez-vous faire, nous sommes à la campagne. Son mari l’a conduite trois quarts d’heure plus loin jusqu’à Nice, aux urgences d’un hôpital de la ville. C’est là qu’elle est décédée la nuit même. Son mari a le cœur brisé de l’avoir abandonnée cette nuit-là justement, de ne pas lui avoir tenu la main.

Et maintenant, Maria est morte. Elle était hors d’elle et restait inconsolable que sa fille soit partie avant elle. Maria était une bergère. Elle était bergère corps et âme. Les chèvres et les moutons étaient sa vie. Elle n’avait guère été à l’école, savait à peine lire et écrire, mais elle avait un autre savoir : Une connaissance profonde des plantes, des animaux et du temps, de la nature qui nous entoure et des hommes. Elle a travaillé toute sa vie et a toujours eu des animaux. De moins en moins ces dernières années, la plupart du temps elle se contentait de nourrir les agneaux qui étaient trop faibles pour participer à la transhumance annuelle, la montée des moutons dans les montagnes. Toutes les deux heures, elle leur donnait le biberon. Une fois, je lui ai apporté un agneau qui était restée sur le bord de la route, affaibli. Sa mère l’avait rejeté et il était presque mort de faim. Lorsque je suis arrivée dans la cuisine avec le petit mouton dans les bras, elle a simplement hoché la tête et s’est levée. Elle n’a jamais oublié que le petit mouton était mort quelques semaines plus tard. Les animaux meurent parfois, disait-elle alors en haussant les épaules. On ne peut pas pleurer pour chaque animal. D’ailleurs, on ne pleure pas ici. La vie dans la nature et avec les animaux est dure. Je me suis alors ressaisie et j’ai seulement essuyé furtivement les larmes de mes yeux. Il y a quelques semaines, elle m’a dit qu’elle n’avait probablement pas rendu le lait en poudre assez nourrissant. Parmi les dizaines de milliers de moutons qu’elle a élevés et gardés, elle n’a jamais oublié “mon” petit mouton qui n’a pas survécu. D’ailleurs, elle n’a jamais rien oublié. Elle connaît Monsieur depuis l’enfance de ce dernier et lui posait de temps en temps des questions et se souvenait de telle ou telle chose qui remontait à plus de soixante-dix ans. Pendant un certain temps, la mère de Monsieur, la fille du banquier, et Maria, la bergère, deux femmes qui ne pouvaient guère être plus opposées, étaient les deux doyennes du village. Toutes deux aspiraient à devenir centenaires et se demandaient sans cesse, avec respect, quel âge avait l’autre. Mais seule Maria a atteint la centaine, voire les cent deux ans. Une petite victoire en fin de compte.
Depuis que je connais Maria, elle avait du mal à marcher et se laissait pratiquement tirer par sa brouette motorisée, avec laquelle elle se déplaçait d’un bout de jardin à un bout de pré pour récolter des haricots ici et couper l’herbe là, avec une faux, pour les lapins. La faux lui servait également de support. Elle ne pouvait pas ne rien faire. En hiver, par beau temps, elle s’asseyait au soleil devant la grange, mais elle ne restait jamais inactive : elle tressait des paniers avec ses mains déformées par le rhumatisme. Et plus tard, elle tirait du bois pour le poêle depuis la grange jusqu’à la maison dans un panier à linge monté sur des skis. Ce n’est que les dernières années, lorsque ses jambes ne la portaient plus et qu’elle était clouée à la maison, qu’elle a été contrainte d’arrêter de travailler, et elle ne cessait de s’en plaindre. Elle ne servait plus à rien, disait-elle. Elle était assise lourdement sur sa chaise et attendait le repas et qu’on lui apporte les nouvelles du monde dans la cuisine surchauffée. Il y a à peine deux semaines, malgré tous les soins des infirmières, et surtout malgré le dévouement de Cathy, l’aide ménagère et bien plus, et de Damiano, son gendre (tous deux à bout de forces), elle était dans un tel état physique qu’il a été décidé qu’elle ne pouvait plus rester à la maison et devait être hospitalisée. J’étais présente ce jour-là et c’était déchirant. Elle ne voulait pas et pleurait fort et amèrement. “L’hôpital c’est la fin”. Nous avons tous pleuré aussi. Jusqu’à la fin, elle était bien éveillée dans sa tête, mais son corps était fatigué. Et le chagrin d’avoir perdu sa fille a fait le reste.
Rosette et Maria ne sont plus là, mais restent dans nos cœurs. Rosette était notre témoin de mariage. Et elle m’a aussi inspiré l’un de mes personnages de roman. Nous ne les oublierons jamais.





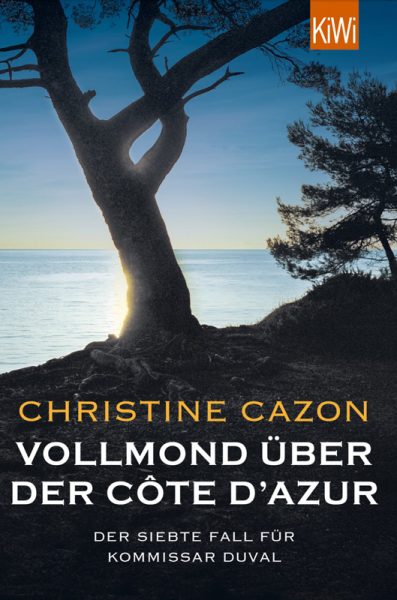

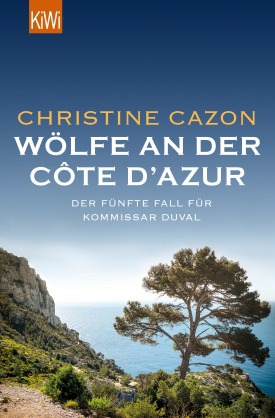
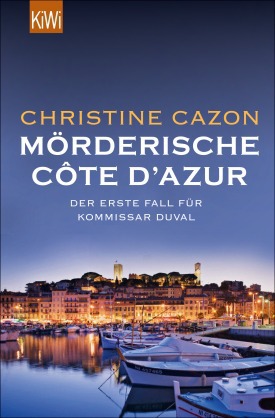


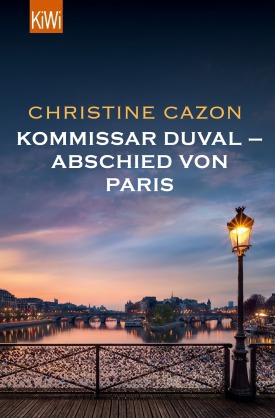
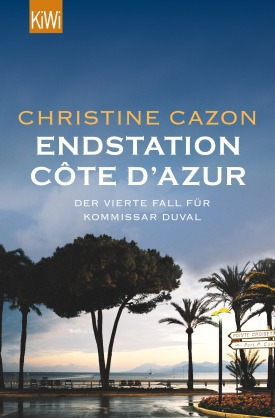
C’est très très beau Christiane 💕
Oh! Merci Valérie 🙏💗😘 cela me touche beaucoup 💕
Ihr Nachruf geht mir an und ins Herz.
Aufrichtige Anteilnahme.
Lieben Dank!
Es hat mich sehr berührt, wie sie diesen Nachruf geschrieben haben – Danke!
Liebe Grüße, Gundula
Lieben Dank!
Was für ein rührender Bericht.
Vielen Dank Christiane, dass Du uns in DEIN
Dorf in den Bergen mitgenommen hast.
Alles Gute und liebe Grüße Uschi
Sehr gerne liebe Uschi! Danke fürs Lesen!
Was für ein wunderbarer und herzzereißender Nachruf auf die Beiden.Man sieht sie vor sich, als wäre man auch ein Teil dieser ganzen langen Zeit. Herzlichst und traurig, Sunni
🖤 Merci 🖤